Die akademische Diskussion, besonders in der ohnehin recht
traditionsorientierten deutschsprachigen Romanistik, hat eine Zeitlang
gebraucht, um das Internet und die Hypermedien als Untersuchungsgegenstand
für sich zu entdecken.1 Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass
im Umgang mit dem Internet das Selbstverständnis der Literaturwissenschaft
auf dem Spiel steht:
Inwieweit kann und soll man das Internet und die Hypermedien als
Öffnung auf eine post-literarische Kultur verstehen, als Epochenbruch, der
auf die akademisch geprägte Schriftkultur höchstens noch im Modus der
Nostalgie zurückblicken lässt, wenn man sie nicht überhaupt fröhlich oder
fatalistisch über Bord wirft (so zumindest der teils euphorische, teils
apokalyptische medientheoretische Diskurs der achtziger und frühen
neunziger Jahre)? Die Beschäftigung mit der Netzkultur in ihrer ganzen
Breite erfordert offensichtlich die Erweiterung einer engen Konzeption von
Literaturwissenschaft in die weiten Gefilde von Kultur- und
Medienwissenschaft. Technische Medien werden in dieser Perspektive als
Ermöglichungsbedingungen eines neuen Weltverhältnisses verstanden, das
sich im Umgang mit dem Internet vielleicht am deutlichsten
manifestiert.
Gleichzeitig entstehen jedoch, sei es in ästhetischer, sei es in
wissenschaftlicher Absicht, immer mehr Internet- oder hypermediale
Projekte, die sich selbst strenge Regeln vorschreiben, mit denen sie
bewusst in Dialog mit dem Kanon der ästhetischen bzw. philologischen
Tradition treten. Es geht hier also nicht mehr um 'Netzkultur' im
entgrenzten Sinn, sondern vielmehr um hochspezialisierte, z.B. editorische
Praktiken. Technische Medien werden in diesem Zusammenhang in
methodisch kontrollierter Art und Weise zu potenten Werkzeugen einer
Praxis, die ihre eigentliche Legitimation aus der literarischen bzw.
philologischen Tradition bezieht.2
In meinem Beitrag möchte ich nicht von vornherein für eine der beiden Seiten, für das
kulturwissenschaftliche Abtauchen in die ganze Breite der Netzkultur oder
für die philologischen Rückgewinnungsversuche Partei ergreifen. Geboten
wäre es vielmehr – und vielleicht liegt hier auch eine Chance der
'konservativen' romanistischen Perspektive gegenüber beispielsweise der
'trendigeren' Germanistik –, die Spannung zwischen der
kulturwissenschaftlichen Apriorität und der philologischen
Instrumentalität technischer Medien, zwischen der populären Netzkultur und
den spezialisierten 'Anwendungen' der Hypermedien bzw. des Internet auf
möglicherweise produktive Effekte hin auszuloten.
Der Fragehorizont bei Gumbrecht zielt, wenn man es mit anderen Worten
formuliert, auf die subjektive Aneigenbarkeit und Bewältigbarkeit von
Wissen in Abhängigkeit von bestimmten Medienpraktiken, die an die Stelle
der Fiktion einer autonomen Subjektivität oder Autorschaft eine schwache,
selbstpraktische Form von Subjektivität treten lassen. Überraschend an
Gumbrechts Gedanken ist allerdings, dass er einer in Ehren ergrauten
philologischen Pflichtübung,4 nämlich dem
Kommentieren, die Lösung einer derartigen Aufgabe zutraut und die
philologische Kommentarpraxis sogar zum Vorbild für den Umgang mit dem
Internet aufbaut. Zugespitzt formuliert, fordert Gumbrecht
Rephilologisierung nicht nur für Philologen, sondern auch als
Bildungsprogramm für den durchschnittlichen Internetsurfer.
Der Grund dafür, dass diese Vision so überzogen klingt, liegt wohl darin, dass
Gumbrecht hier zwei ganz unterschiedliche Kommentar-Begriffe, einen
philologischen und einen auf hypertextuelle Verknüpfung im Internet
bezogenen, ineinander fließen lässt.5 Das Interessante an Gumbrechts allzu optimistischer Selbstüberschätzung des
philologischen Eros scheint mir aber dennoch der Gedanke, dass über die
Praxis des Kommentierens überhaupt ein Bezug zwischen dem
institutionalisierten philologischen Kommentar und dem relativ
ungeregelten Kommentieren im Internet herzustellen ist. Es geht im Sinn
meines eingangs erläuterten Vorschlags, das Verhältnis von philologischer
und kultureller Praxis zu denken, nicht darum, den philologischen
Kommentar zum Modell des Kommentierens überhaupt zu machen, sondern
umgekehrt darum, die Differenzen zwischen verschiedenen Kommentarformen,
aber vielleicht auch ihre gemeinsamen Wurzeln in medialen
Umbruchsituationen deutlich zu machen.
Historisch gesehen hängt die Tätigkeit des Kommentierens wesentlich
mit verschiedenen Formen von Sprachlichkeit und insbesondere von
Verschriftlichung zusammen. Ich baue dabei auf der Annahme auf, dass Kommentare vor allem in historischen,
genauer: in mediengeschichtlichen Umbruchsituationen eine besondere
Bedeutung erlangen.6 Dies soll an einer sehr kurzen Skizze der
wichtigsten Stationen einer Mediengeschichte des Kommentars verdeutlicht
werden:
Nach Jan Assmann fällt der genealogische Ursprung des Kommentars – nach
einer Vorgeschichte in der nicht schriftlich fixierten Hermeneutik, v.a.
im Rahmen sakraler Handlungen – weitgehend mit der Entwicklung der Schrift
zusammen. Schriftlichkeit stellt nach Assmann einen ungeheuren
Komplexitätsgewinn insofern dar, als sich "erst jetzt [...] ein Gedächtnis
aus[bildet], das weit über den Horizont des in einer jeweiligen Epoche
tradierten und kommunizierten Sinnvorrats hinausgeht und den Bereich der
[sc. mündlichen] Kommunikation drastisch überschreitet" (Assmann 1995: 23).
Kommentare dienen der Markierung und Kanonisierung von bestimmten
Schlüsseltexten, die fortan das 'Innen' einer gesellschaftlichen Ordnung
bilden. Der so konstituierte "Sinnvorrat" einer Gesellschaft wird durch
ständige Kommentierung aktualisiert und ggf. im Laufe der Zeit verschoben.
Karlheinz Stierle hat noch weiter zwischen Kommentaren unter den
Bedingungen von Hand- und Druckschriftlichkeit differenziert und
festgehalten, dass handschriftliche Kommentare immer an den
Zwischenschritt einer mündlichen Aktualisierung in der lectura
gebunden sind, während erst das gedruckte Buch zum Ort wird, wo
verschiedenste Schriftpraktiken auf dem medialen Substrat der Druckseite
zueinander finden:
Gleichzeitig wird es nach Stierle mit dem Buchdruck auch möglich,
einzelne kanonische Texte zurückzuweisen bzw. gegen bestehende Texte einen
neuen Kanon zu profilieren. Im Medium der Druckschrift kann auch eine
grundlegende Kritik institutionalisierter, d.h. autoritätsorientierter
scholastischer Kommentarformen erfolgen, wie sie sich bspw. in den
Essais von Michel de Montaigne ausdrückt.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass damit, selbst im Schreiben Montaignes, das Kommentieren als
fortlaufende Praxis ganz abgeschafft wäre (ich werde auf die Spannung
zwischen institutionalisierten und sich davon absetzenden 'subjektiveren'
Kommentarpraktiken später zurückkommen).
Schließlich steht die Institutionalisierung des 'geschlossenen'
philologischen Kommentars7 im Zeichen
einer sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer deutlicher herausbildenden
Konkurrenz von Schrift und anderen, technischen Speichermedien: Dieses
Bewusstsein äußert sich zunächst indirekt in einer zunehmenden
Sensibilität für die Textualität bzw. Materialität des Textes, die von der
Rekonstruktion eines Ur-Textes nach Lachmann vor allem für moderne Texte
zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit auf die Textgenese und das Verhältnis von
Drucktext und Manuskript geführt hat.8
Mit der Institutionalisierung des Kommentars zur philologischen
Spezialdisziplin geht aber gleichzeitig eine immer weitere Ablösung der
Kommentarpraxis vom kulturell 'zirkulierenden' Sinnbestand einer Kultur
einher. Zwar bieten Hypermedien fraglos interessante neue Möglichkeiten
innerhalb der Grenzen des philologischen Kommentars, aber ist nicht die
Verbindung philologischer Editionen zum Großteil des kulturell
zirkulierenden Wissens längst abgerissen? Und steht das kulturell
zirkulierende Wissen überhaupt noch im Zeichen der Schrift oder eher eines
jüngst propagierten iconic turn der Kulturwissenschaften?
Ziel dieses Beitrags ist es, die Verbindung und somit die Beziehbarkeit
von 'geschlossenem' philologischem und 'offenem' Kommentar, der versucht,
eine Lesbarkeit von nicht notwendig schriftlich fixierten kulturellen
Praktiken herzustellen,9 nicht ganz abreißen zu lassen.
Dies setzt jedoch die Annahme voraus, dass Sprache und Schrift auch heute,
d.h. im Zeitalter elektronischer Medien, in entscheidender Weise das
kulturelle Gedächtnis prägen. Diesbezüglich hat Hartmut Winkler (1997) bereits vor einigen
Jahren nachdrücklich herausgestellt, dass die Anwendung eines
zeichentheoretischen Zugangs auch für elektronische Medien noch Sinn ergibt, ja, dass auch
diese primär immer noch im Zeichen semiotischer Differenz zu untersuchen
sind.
Wenn man sich nach Winkler, dessen Gedanken in anregender Weise
zwischen verschiedensten Theorieentwürfen und Schulen zirkulieren,10 mit der Medialität des Computers
beschäftigen will, so ist es irreführend, mit dem neuen Medium eine
Ablösung bisheriger Medientechniken durch ein Über-Medium, das alle bisher
bestehenden Medien integriert, zu erwarten. Computergebrauch ist nach
Winkler entgegen einem weit verbreiteten Mythos nicht integrativ, sondern
genauso partikular wie andere technische Medien auch; die Vergleichbarkeit
zwischen einzelnen Medien wird nach Winkler jedoch dadurch hergestellt,
dass sie alle als symbolisch strukturiert zu denken sind, d.h. nach dem
Modell einer Sprache funktionieren. Winkler legt dabei seinen Überlegungen,
die mit der Opposition von langue und parole, also von
Sprachsystem und Äußerung operieren, einen medientheoretisch folgenreichen
dynamischen Begriff von sprachlichen Systemen zu Grunde (vgl. Winkler
1997: 14–53).
Dazu kommt, dass Winkler vor einem psychoanalytischen Hintergrund
Medien als privilegierten Gegenstand menschlicher Wünsche und damit
Computer in einem buchstäblichen Sinn als "Wunschmaschinen" betrachtet
(vgl. Winkler 1997, 54–80). Der (utopische) Wunsch, der sich mit dem
Medium Computer und speziell mit der Vernetzung von Computern zu
Netzwerken verbindet, ist nach Winkler derjenige, das komplette System der
Sprache zu 'externalisieren', d.h. letztlich aus dem World Wide
Web ein Netz des gesamten menschlichen Wissens zu machen, das
irgendwann jederzeit und restlos abrufbar wäre. Charakteristische
Metaphern dafür sind zum einen – als Entlehnung aus der Buchkultur – die
Enzyklopädie, ein Paradigma, das im Internet immer wieder bemüht wird, und
zum anderen – mit noch weiter reichenden Ansprüchen – die Annahme vom
hypertextuell vernetzten Denken als veräußerter Entsprechung zur
'synaptischen' Verschaltung des menschlichen Gehirns an sich.
Gegen diese Wünsche setzt Winkler die Beobachtung, nach der die
Phantasie von der restlosen Speicher- und Abrufbarkeit des Weltwissens zu
Gedächtnishypertrophie führt. Der Grund dafür liegt darin, dass technische
Gedächtnisse allein ohne Selektion bzw. das, was Winkler in Anlehnung an
Freud "Verdichtung" nennt, scheitern müssen (vgl. Winkler 1997, 131–184).
Winklers Studie versucht zu zeigen, wie Verdichtung nicht nur
individualpsychologisch, sondern auch und vor allem im Rahmen eines
kollektiven Gedächtnisses erfolgt, das – so seine Formulierung – Daten
speichert, indem es sie "in die Sprache hinein" vergisst (Winkler 1997:
164).
Meine Analysen schließen an Winkler an, versuchen aber zusätzlich,
einen Aspekt zu fokussieren, den dieser ausklammert: Ich möchte
Kommentarpraktiken nicht nur im Rahmen einer kollektiven Diskursordnung
untersuchen, sondern auch sich daraus ergebende individuelle Formen der
Subjektkonstitution, die durch bestimmte technische Vorbedingungen des
Internet möglich werden. Auch untersuche ich in meinen Analysen nicht die
'tiefer liegende' Ebene der Programmierung von Computern, sondern
beschränke mich auf einen bestimmten wissenschaftlich-ästhetischen
Anwendungsbereich innerhalb der Computernutzung, spezieller: innerhalb der
Nutzung von Hypermedien im Internet.
Kommentierende Netz-Anwendungen – so meine These – können
möglicherweise von ausgezeichneter Bedeutung bei der sprachlichen
Bewältigung der ungeheuren Diskursvielfalt bzw. bei der Etablierung eines
(mehr oder weniger einheitlichen und stabilen) kulturellen Gedächtnisses
sowie individueller Selbstpraktiken im Rahmen einer Diskurs- und
Gedächtnisordnung sein.
Eine letzte Vorbemerkung soll dem Begriff des
Kommentars selbst gelten: Der Kommentarbegriff, den ich hier verwende, soll
nicht in einem definitorisch engen Sinn an die Präexistenz von
kanonischen, kommentarwürdigen Texten gebunden werden; vielmehr kann nicht
textuell Verfasstes zum Gegenstand von Kommentierung werden, wobei
sich Kommentare jedoch dadurch auszeichnen, dass sie solche Sachverhalte
in eine sprachliche Bearbeitung überführen.
Damit komme ich nun zu meinem angekündigten Thema, der Analyse
einer vor allem kommentierend operierenden Internetanwendung, die sich
seit einigen Jahren großer und noch immer rapide wachsender Beliebtheit
erfreut: Die Rede ist von so genannten Weblogs.
Ich beginne mit einer Begriffsklärung. Hier zunächst der Anfang einer
im Netz kursierenden Weblogdefinition:
Die Menüleiste auf der rechten Seite zeigt weitere typische Features
von Weblogs, wie z.B. die Liste der Themen, zu denen Weblogeinträge
vorhanden sind, eine Suchfunktion, sowie in der Regel eine "Blogroll",
d.h. eine Linkliste mit anderen Blogs o.ä. Was die technische Umsetzung
betrifft, handelt es sich im Prinzip um 'normale' Webseiten in HTML oder
in XML. Besonders an Weblogs ist vor allem, dass sie Software-'Tools'13 darstellen, die das schnelle und häufige
Publizieren im Netz sowie die Verwaltung des Publizierten in Archiven
vereinfachen. Technisch handelt es sich dabei um serverbasierte
cgi-Skripte, die nur Internetzugang erforderlich machen und das Schreiben
von Weblogs vom Browser aus ermöglichen (vgl. Abb. 2). So erübrigt sich nicht nur die
zeitaufwändige Trennung in die verschiedenen Arbeitsschritte des
Offline-Erstellens der Seiten sowie das anschließende Übertragen per FTP,
zusätzlich wird auch das Layout des Weblogs nicht für jeden Eintrag neu
entworfen, sondern ist als eine allgemeine Maske vordefiniert, womit man
sich auch ohne HTML- oder ähnliche Kenntnisse auf das Schreiben der
Einträge konzentrieren kann.
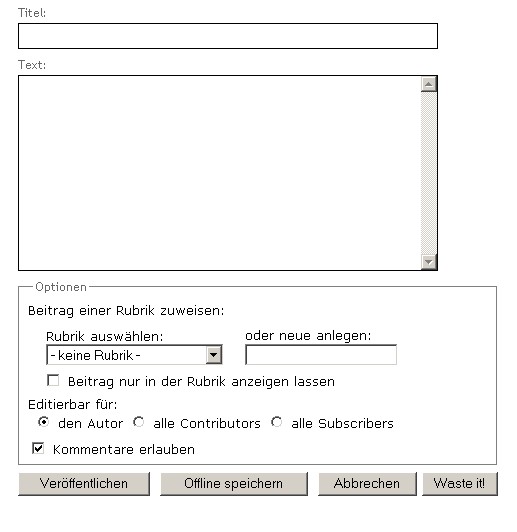
Abb. 2: Das Menü bei twoday.net zum Verfassen von Weblogbeiträgen (September 2003)
Es gibt Software-Lösungen wie Movable Type (http://www.movabletype.org/), die
das Publizieren von Weblogs auf dem eigenen Server erlauben; andere
Anbieter kombinieren ihr Software-Angebot mit der Einrichtung von Webspace
auf vorgegebenen Servern, so z.B. der deutschsprachige Weblog-Pionier
Antville (http://www.antville.org/).
Die Geschichte der Weblogs reicht bis in die Mitte der 1990er Jahre
zurück: Sie wurden ursprünglich zur Vereinfachung der Publikation von
What's new-Seiten entwickelt.14 Bis vor
kurzem noch eine Art Geheimtipp einer mehr oder weniger eingeschworenen
Gemeinschaft, erleben sie derzeit einen wahren Boom (ihre Zahl erreicht
inzwischen Millionenhöhe, Tendenz bisher stark steigend),15 der auch mit einer stärkeren
Kommerzialisierung einhergeht.16 Immer mehr
der zunächst zumindest in einer Basisversion kostenlosen Angebote werden
inzwischen kostenpflichtig oder finanzieren sich über Werbebanner (beide
Möglichkeiten bietet z.B. der Antville-Ableger Twoday.net).17 Weblogs haben sich nicht zuletzt durch den
Versuch einer Herstellung von kritischer Gegenöffentlichkeit in der Zeit
des Irakkriegs größere mediale Aufmerksamkeit verschafft; neben
journalistischen Weblogs gibt es aber viele andere private,
wirtschaftliche sowie wissenschaftliche Anwendungsbereiche, auf deren
Gemeinsamkeiten ich noch zu sprechen kommen werde.
PhiN-Beiheft 2/2004: 43
Ein Indiz für die
wachsende Bedeutung von Weblogs für verschiedene, auch kommerzielle
Interessen besteht schließlich darin, dass die amerikanische Firma Pyra
Labs, die hinter dem weltweit größten Weblog-Anbieter Blogger (http://www.blogger.com/) steckt, Anfang
2003 von Google übernommen wurde, wodurch sich die Suchmaschine
offensichtlich eine Stärkung ihrer Marktposition erhofft.18
Die Besonderheit von Weblogs als Software-Tools besteht somit in
erster Linie darin, dass sie das Publizieren im Netz stark vereinfachen –
gleichzeitig hat sich mit Weblogs jedoch auch (bedingt zumindest zum Teil
durch die Möglichkeiten der inzwischen bei den verschiedenen Anbietern
weitgehend vereinheitlichten Möglichkeiten und Grenzen der Software
selbst) ein neues Format des Schreibens im Internet herausgebildet,
das hier aufgrund seiner Nähe zur Kommentartradition untersucht werden
soll..19
Eine kurze Beschreibung der Tätigkeit des Bloggens durch Peter Praschl,
verantwortlich für eines der meistgelesenen deutschen Weblogs namens
Sofa (http://arrog.antville.org/), lautet:
"Weblogger jagen, sammeln und annotieren Links." (Praschl [o.J.]) Der
Akzent dieser Beschreibung liegt auf der grundsätzlichen Linkorientierung
der Weblogs, die an und für sich bereits affin zur Kommentartätigkeit ist.
Ich will hier nicht näher auf die breite Diskussion um Hypertextualität
seit den neunziger Jahren eingehen20 und auch
nicht näher diskutieren, ob der oft bemühte Vergleich zwischen
Hypertextualität und Intertextualität in einem ästhetischen Sinn überhaupt
plausibel ist,21 oder ob Hypertextualität nicht mit gleichem
Recht als eine – mit Gérard Genette gesprochen – Form von Metatextualität
betrachtet werden kann.22 Für meine
Zwecke möchte ich das Kommentieren im Internet nicht nur strukturell durch
den bloßen Verweis auf einen anderen Text via Hyperlink, sondern auch
semantisch durch den meinungsbezogenen Umgang mit Hyperlinks
bestimmen.
Als kurzes, jedoch für Weblogdiskussionen nicht untypisches Beispiel
soll hier die Diskussion um eine Tagung zur Zukunft des Feuilletons und
speziell der am 20. September 2003 im Perlentaucher online
erschienene Beitrag von Thierry Chervel zum Verhältnis von Internet und
Feuilleton dienen, in dem Chervel davon ausgeht, dass die Print-Presse den
derzeitigen medialen Strukturwandel der Öffentlichkeit verschlafen habe
(Chervel 2003).23 Chervels Beitrag wird von einem Weblogger
namens "Supatyp" (http://mark.antville.org/)
folgendermaßen kommentiert (Supatyp
2003, vgl. Abb. 3):
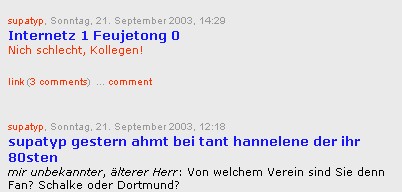
Abb. 3: Ausschnitt der Startseite von http://mark.antville.org (22.9.2003)
PhiN-Beiheft 2/2004: 44
Ohne den knappen Eintrag in allzu philologischer Manier analysieren zu
wollen, zeigt sich an ihm doch recht gut, dass die Kommentar-Semantik, die
den Link begleitet, in Weblogs oft ziemlich verknappt und zugespitzt ist,
hier auf ein Fußballergebnis ("Supatyp" hat sich in seiner
Rollendefinition als Blogger übrigens einen rheinländischen Proll-Dialekt
zu eigen gemacht, den er karikierend auf die Spitze treibt).
Kommentierte Links sind aber nicht das Einzige, was Weblogdiskussionen
ausmachen – es können nämlich innerhalb des Weblogs auch Kommentare zu
Kommentaren entstehen, was im bereits genannten Beispiel wieder in
schnörkelloser Direktheit deutlich wird (vgl. Abb. 4).
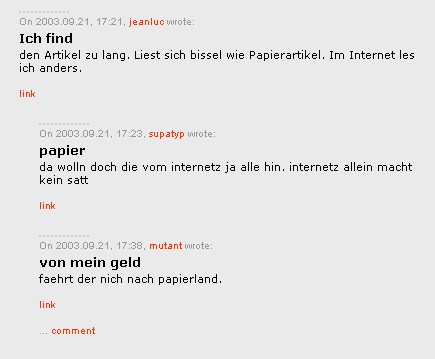
Abb. 4: Kommentare zu http://mark.antville.org/stories/520973/ (22.9.2003)
Kommentare zu Weblog-Einträgen werden nicht mehr auf der chronologisch
geordneten Startseite, sondern in einer eigenen Seite dargestellt,24
die mit dem kommentierten Eintrag des "Supatyp" beginnt und
die Kommentare darunter aufführt. Auf den Einspruch gegen sein Lob
antwortet "Supatyp" mit einem Kommentar dritter Stufe – ein Spiel, das
prinzipiell endlos immer eine Stufe höher getrieben werden kann.
Die als Standard-Feature in Weblog-Software vorgesehene Möglichkeit des
Kommentierens ist jedoch an eine vorgängige Registrierung als Nutzer
entweder des Weblog-Dienstes oder des speziellen Weblogs selbst gebunden
(in Verbindung damit kann die Lektüre, Kommentierung und auch das
Schreiben von Einträgen für Weblogs spezifisch geregelt werden – von
non-public-Weblogs, die nur für eine bestimmte Zahl von Usern
überhaupt lesbar sind, bis hin zu öffentlichen Weblogs, in denen jeder
User Beiträge und Kommentare verfassen kann, sind verschiedene Zwischenstufen
möglich.)
PhiN-Beiheft 2/2004: 45
Der innerhalb der Weblog-Community zeitweise heiß diskutierte
Sinn bzw. Unsinn der Möglichkeit, Weblogs 'privat' zu führen, d.h. auf
einen bestimmten Nutzerkreis einzuschränken,25 zeigt, dass
die Netzutopie einer allgemeinen Zugänglichkeit offensichtlich auch und
gerade in der Weblog-Gemeinschaft bedeutend eingeschränkt wurde und wird,
dass sich also einem bestimmten Zweck angepasste Diskursgemeinschaften
herausbilden, die ihre je eigene Form von Öffnung auf das oder Schließung
gegenüber dem Netz propagieren.
Über die interne Kommentierung hinaus können Weblog-Einträge jedoch
auch von anderen Weblogs aufgegriffen werden, sei es, um die Information
des Eintrags zu übernehmen, sei es, um durch eigene Kommentare eine neue
Diskussion zu dem Thema zu eröffnen.
Faktisch ist die Zirkulation von Informationen zwischen Weblogs sehr
verbreitet. Die Frage, warum dies so ist, hat nicht nur mit der
Selbstreferentialität von eingespielten Diskurs- bzw. hier:
Kommentargemeinschaften, sondern auch mit einer weiteren technischen
Besonderheit von Weblogs zu tun, die in Zusammenhang mit Weblogs
entwickelt wurde, jedoch nicht prinzipiell auf sie beschränkt ist. Weblogs
haben eine Form der Informationsvermittlung entwickelt, die nicht nur
aktiv bestimmte Themen aus dem Netz herauszieht und dabei Suchmaschinen
verwendet oder bereits bekannte URLs ansteuert, sondern auch aus
bestimmten voreingestellten Quellen ohne eigenes Zutun mit Informationen
versorgt wird, meist von anderen Weblogs.26 Inzwischen
nutzen viele Weblogs dieses Angebot, die sogenannten RSS-Feeds im Rahmen
der Textmarkierungssprache XML, einer Weiterentwicklung von HTML (vgl.
dazu einführend Kantel
2003). RSS wurde von dem Weblogpionier Dave Winer entwickelt, auch
wenn es sich allmählich von der reinen Weblog-Nutzung abzulösen beginnt
und aktuell mehrere konkurrierende Versionen auf dem Markt sind.27 In einem RSS-Feed (die Abkürzung bedeutet u.a.
"Rich Site Summary") werden bspw. Titel, Datum sowie wichtigste Inhalte der Neueinträge in einer URL erfasst und automatisch an alle
Internet-User geschickt, die die URL 'abonniert' haben und die letzten
Aktualisierungen der sie interessierenden Blogs mittels einer speziellen
RSS-Lesesoftware geliefert bekommen.
Um beim Beispiel des Kommentars von "Supatyp" zur Feuilleton-Diskussion
zu bleiben: Mit einem Programm wie Feedreader (vgl. Abb. 5) ist es für andere
Blogs wie z.B. das von mir initiierte romblog (http://romblog.twoday.net/) möglich,
sich über die neuesten Einträge des "Supatyp" und anderer regelmäßig
gelesener ('abonnierter') Weblogs zu informieren und wiederum
kommentierend auf sie zu verweisen.
PhiN-Beiheft 2/2004: 46
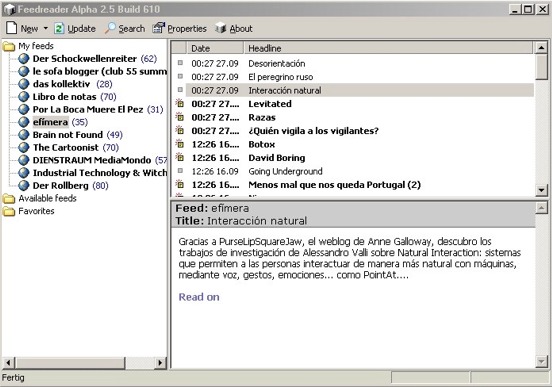
Abb. 5: Feedreader in der Konfiguration des Verf. am 27.9.2003 (beim Ansehen der Neueinträge des spanischen Weblogs http://www.efimera.org)
Schließlich kann man im Rahmen einer Einrichtung namens
Trackback, über die jedoch nicht alle Weblogs verfügen, nunmehr
wiederum aktiv vom eigenen Blog aus dem anderen
Weblog mitteilen, dass man es soeben verlinkt und kommentiert hat – im
Fachjargon: Man kann es "anpingen".28 Das so
kontaktierte Weblog kann seinerseits wiederum automatisch auf den
entfernten Kommentar verweisen, damit seine Leser das Echo, das die
Weblogeinträge anderswo gefunden haben, zurückverfolgen können.
So weit eine einführende technische Beschreibung der Möglichkeiten von
Weblogs.
2.2 Funktionen des Weblogkommentars
Hartmut Winkler hat 1997, also vor Verbreitung von Weblogs, folgende
Zukunftsprognose zur Entwicklung des Internet formuliert:
|
Das gegenwärtige flüchtige Nebeneinander der heterogensten
Informationen lebt von der Utopie, eine Hierarchisierung vermeiden
zu können und – ein basisdemokratisches Ideal – peripheren Projekten
gegen die etablierten Strukturen eine Chance zu geben. Aus der hier
vertretenen Argumentation zu Vergessen und Verdichtung allerdings
ergibt sich eine vollständig andere Prognose: wenn das Prinzip der
additiven Speicherung linear in die Krankheit Seresvskijs [d.h. die
Mnemopathie oder Hypertrophie des Gedächtnisses, beschrieben vom
russischen Psychiater Lurija, J.D.] führt, wird das Datenuniversum
sich nur retten können, wenn es Mittel findet, Hierarchien auch in
dem neuen Zeichensystem wieder durchzusetzen. Man wird erkennen
müssen, daß Hierarchien eine semantische Funktion erfüllen und daß
semantische Systeme grundsätzlich hierarchisch sind; polyzentrisch
selbstverständlich, und keineswegs nach dem Muster einer Pyramide
strukturiert, dennoch aber hierarchisch in der Verwaltung
qualitativer Unterschiede, unterschiedlicher Verweisdichten und
unterschiedlich tief gegrabener Bahnungen. Die Prognose also ist,
daß im Datennetz 'Orte' unterschiedlicher Bedeutung sich
herausbilden werden. Es wird ein Unterschied sein, wieviele Links
die einzelnen Orte auf sich vereinigen können, wie 'direkt' –
organisatorisch, nicht technisch – sie zugänglich sind. Und es wird
eine gesellschaftliche Auseinandersetzung um diese Positionen geben.
Auch in diesem Sinn also wird das Datenuniversum in die Geschichte
eintreten. Und schließlich jenes getreuliche Abbild der
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sein, das der
Anfangs-Enthusiasmus zuverlässig glaubte vermeiden zu können. Die
Realgeschichte des Datenuniversums also wird zur Herausbildung von
'Monumenten' führen. (Winkler 1997:
180) |
PhiN-Beiheft 2/2004: 47
Es stellt sich die Frage, ob Weblogs in dem gesellschaftlichen Spiel
der Verdichtung und Schaffung von 'Monumenten' im Netzdiskurs mit ihrer
spezifischen Kombination aus neuen technischen Selektionsmöglichkeiten und
individuell-subjektgebundener Kommentarpraxis tatsächlich eine Rolle
spielen. Einer der am meisten beachteten jüngeren Beiträge über Weblogs
von Christian Eigner stellt eine andere Prognose auf. Eigner legt den
Akzent nicht auf Verdichtung, sondern ist im Gegenteil hoch erfreut
darüber, dass das Internet gerade dank der Weblogs vor der
'Monumentalisierung' bewahrt werden könnte. Er spricht davon, dass die
Internet-Medienkultur der Zukunft durch so genannte "Oszillationsmedien"
bestimmt sei, deren erste Verteter die Weblogs seien:
|
Weblog-Einträge – wie sollte man diese neuen Entitäten sonst
nennen? – sind wohl die erste Textform, die tatsächlich keinen Rand
mehr hat. Nicht nur ihr Sinn weist weit über sie hinaus (was
allerdings für die meisten Texte gilt), auch formal ist schwer
festzulegen, wo ein Weblog-Eintrag beginnt und wieder aufhört: Der
Eintrag schreibt ja den Link fort, führt ihn inhaltlich wie auch
formal weiter – und damit auch das, was hinter dem Hyperlink steckt.
'Texte' entstehen so, die unbegrenzt sind, die folglich kein 'Außen'
und kein 'Innen' mehr kennen, die sich dauernd öffnen [...] und
wieder verschließen [...], die mit einer Heftigkeit zwischen diesen
beiden Polen (offen – geschlossen) oszilllieren, daß man als Leser
einer Sammlung von Weblog-Einträgen (also eines Weblogs) permanent
den Eindruck hat, noch auf einer (runden, produktartigen)
Medien-Site zu sein, aber schon auch durch das Netz katapultiert zu
werden. (Eigner
2002: 110) |
Die Beschreibung einer "Oszillation" zwischen dem Weblog als eigenem
Format und den durch Weblogs verlinkten Seiten erscheint reizvoll und auf
den ersten Blick durchaus plausibel, doch greift sie insofern zu kurz, als
Eigner von einer grundsätzlichen Ungerichtetheit dieser Bewegung ausgeht –
genau dies würde Hartmut Winkler wohl als Ausdruck der
Nichthierarchisierungsutopie verstehen und dagegen halten, dass die
Verlinkung in Weblogs eher der Hierarchisierung des Netzdiskurses dient.
Wenn meist auch nicht alle der vielschichtigen Kommentar- und
Vernetzungsmöglichkeiten von Weblogs genutzt werden, so treten Weblogs
doch möglicherweise, wie Peter Praschl schreibt, als "Filter" im
Netzdiskurs auf (Praschl [o.J.]), die faktisch eine Ökonomie der
Konzentration von Aufmerksamkeit29 in Gang
setzen, wobei die von Eigner beschriebene Oszillationsbewegung
rückgebunden wird an einen bestimmten Ort der Verarbeitung.
In Bezug auf die Kommentarpraxis von Weblogs lässt sich Winklers
Vermutung stützen durch den Verweis auf die klassischen Analysen von
Michel Foucault zur Funktion des Kommentars im Rahmen der
gesellschaftlichen Diskursproduktion und -kontrolle, die m.E. auch in der
derzeitigen Netzkultur des Internet nichts von ihrer grundsätzlichen
Aktualität verloren haben. Foucault unterscheidet externe und interne
Verfahren der Einrichtung diskursiver Ordnungen und führt den Kommentar
als erstes der diskursinternen Verfahren auf:
PhiN-Beiheft 2/2004: 48
|
Il existe évidemment bien d'autres procédures de contrôle et de
délimitation du discours [...] Procédures internes, puisque ce sont
les discours eux-mêmes qui exercent leur propre contrôle; procédures
qui jouent plutôt à titre de principes de classification,
d'ordonnancement, de distribution, comme s'il s'agissait cette fois
de maîtriser une autre dimension du discours: celle de l'événement
et du hasard.
Au premier rang, le commentaire. Je suppose, mais sans en être
très sûr, qu'il n'y a guère de société où n'existent des récits
majeurs qu'on raconte, qu'on répète et qu'on fait varier; des
formules, des textes, des ensembles ritualisés de discours qu'on
récite, selon des circonstances bien déterminées; des choses
dites une fois et que l'on conserve, parce qu'on soupçonne quelque
chose comme un secret ou une richesse. Bref, on peut soupçonner
qu'il y a, très régulièrement dans les sociétés, une sorte de
dénivellation entre les discours: les discours qui 'se disent' au
fil des jours et des échanges, et qui passent avec l'acte même qui
les a prononcés; et les discours qui sont à l'origine d'un certain
nombre d'actes nouveaux de paroles qui les reprennent, les
transforment ou parlent d'eux, bref, les discours qui, indéfiniment,
par-delà leur formulation, sont dits, restent dits, et sont
encore à dire. Nous les connaissons dans notre système de culture:
ce sont les textes religieux ou juridiques, ce sont aussi ces textes
curieux, quand on envisage leur statut, et qu'on appelle
'littéraires'; dans une certaine mesure des textes scientifiques.
(Foucault 1971:
23f) |
Natürlich geht es mir nicht um eine Art Urszene des Kommentars im
Rückgriff auf archaische Gesellschaftsordnungen, die Foucault hier
offensichtlich im Blick hat, sondern um die auch für heutige Netzdiskurse
noch gültige Tatsache, dass sich zwischen einzelnen Äußerungen eine
Hierarchie etabliert. Manche Äußerungen geraten so nicht nur in mündlicher
Kommunikation, sondern bei der inzwischen erreichten Masse von
Textproduktion in den verschiedensten Medien auch schriftlich in
Vergessenheit, während manche andere durch kommentierende Fortschreibung
und Kanonisierung im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit bleiben.
Entscheidend an Foucaults Zugriff ist, dass er nicht nur bereits
konstituierte kanonische Texte als Anlass zum Kommentieren betrachtet,
sondern dass er umgekehrt das Kommentieren als Möglichkeitsbedingung für
die Kanonisierung oder Hierarchisierung von Diskursen angibt. Die ist für
Weblogs insofern von besonderer Bedeutung, als sie die besonders
spannungsreiche Schwelle umspielen, die Texte oder Sachverhalte durch
Kommentierung überhaupt erst zu sozial relevanten 'Monumenten' werden
lässt. An dieser Stelle wird das von Foucault erwähnte Gefälle überhaupt
erst hergestellt, das zwischen dem unterscheidet, was im Diskursuniversum
des WWW ungelesen oder zumindest unkommentiert bleibt (was aber bezüglich
der Konsequenzen im Rahmen der beschriebenen Aufmerksamkeitsökonomie
weitgehend auf dasselbe hinausläuft)30 und dem,
was weiter bearbeitet wird.
Ein raffiniertes Experiment mit der Schwelle der Les- und
Speicherbarkeit stellt z.B. ein Weblog namens Wasted comments dump
(http://commentsdump.antville.org/)
dar. Das Weblog ist eine Art Müllhalde für nicht veröffentlichte
Weblog-Postings, die man bei Installierung eines entsprechenden Buttons in
seiner Weblog-Software (s.o., Abb. 2) mit einem Mausklick für die Nachwelt anonym
archivieren kann, anstatt sie zu löschen.
PhiN-Beiheft 2/2004: 49
Natürlich ist diese 'Rettung' des Web-Abfalls31 ein
Spezialfall dessen, was in Weblogs normalerweise bearbeitet wird. Es
stellt sich die Frage – die hier allerdings nur ansatzweise
beantwortet werden kann –, was Weblogs denn eigentlich bevorzugt
verdichten und kommentieren. Auch wenn dies wegen der ungeheuren
thematischen Breite von Weblogs eine fast aussichtslose Frage scheint, ist
wohl doch ein gemeinsamer Nenner möglich: Weblogs, so die vielleicht
erwartbare Antwort, laden sich wie andere Medien auch in einer manchmal
interessanten, bisweilen aber auch entnervenden Selbstreflexion mit
Bedeutung auf. Meta-Blogging, d.h Weblog-Diskussionen über Weblogs findet
sehr häufig die meisten Kommentare.32 Wo es um
andere Themen geht, lässt das Beispiel des erwähnten minimalistischen
Weblog-Kommentars zur Zukunft des Feuilletons vermuten, dass der
semantische Differenzierungsgewinn des Weblog-Kommentars nicht in allen
Fällen sehr hoch ist, wenn es in erster Linie darum geht, Informationen
schnell weiterzuverbreiten und z.B. nach einem groben
Positiv-/Negativschema zu rastern (auf differenziertere Kommentarpraktiken
komme ich weiter unten im Rahmen meiner Überlegungen zu Selbstpraktiken zu
sprechen).
Eine weiter führende Antwort ist aufgrund der immer stärkeren
Ausdifferenzierung von Weblogs beispielweise auf wissenschaftlichem
("K-Blogs"), technischem ("T-blogs") oder journalistischem ("Newsblogs")
Gebiet schwierig bis unmöglich, wobei allein die Ausdifferenzierung selbst
ein Indiz dafür ist, dass die filternde und hierarchisierende Kraft von
Diskursgemeinschaften offensichtlich nur eine sehr begrenzte Reichweite
hat, d.h. es bilden sich im Netzdiskurs allenfalls lokale und begrenzte
Zeit überdauernde Monumente, die von Bedeutung für bestimmte Nutzer sind,
während sie von anderen komplett ignoriert werden.
Interessant scheint hingegen die Beobachtung, dass die kommentierende
Filterung in der Regel komplexer wird, wenn sie nicht an Internet-Links,
sondern an Texte im traditionellen Sinn anschließt. Es gibt einige
Beispiele für interessante Weblog-Diskussionen, die ganz klassisch einen
commentaire de texte zum Gegenstand haben. Auch wenn sich solche
Unternehmungen, wie z.B. eine Lektüregruppe zu Adornos Minima moralia
(http://empire.antville.org/)
explizit vom akademischen Diskurs abgrenzen, führt diese Art von
Weblog-Anwendung auch zum eingangs bereits diskutierten Verhältnis von
philologischem und Internetkommentar zurück.33 Zum einen
ist der Textkommentar natürlich bezüglich der Möglichkeiten des Mediums in
gewisser Weise ein Rückschritt zu einer Instrumentalisierung der Weblogs
im Sinn einer Vereinnahmung für klassische philologische Praktiken – ein
Schritt, der nicht nur in speziell dafür eingerichteten Weblogs, sondern
bisweilen auch in linkorientierten Blogs mehr oder weniger versteckt
zwischen ganz anderen Einträgen vollzogen wird, so z.B. beim Sofa
(Peter Praschl) mit einer unvermittelt eingestreuten Bemerkung zur ersten
Ehebruch-Szene in Flauberts Madame Bovary (Praschl 2003a). Es geht
hierbei nicht mehr um Bildung von künftigen Kommentartraditionen, sondern
der Weblog-Eintrag arbeitet sich in einem klaren, wenn auch kritisch
hinterfragten Gefälle vom kommentierten zum Kommentartext an einem
überlieferten Literaturkanon mit all seinen Reizen und Tücken ab.
PhiN-Beiheft 2/2004: 50
Was
daran wiederum besonders ist – und das zeigt sich m.E. auch in der Art der
Kommentare zu Madame Bovary, die im Prinzip durchaus textnah, aber
mit einer sehr unakademischen Perspektive argumentieren – ist der
Diskussionskontext, in dem weibliche Sexualität hier verhandelt wird:
Emmas Ehebruch steht in unmittelbarer Nachbarschaft zu Einträgen (und
Diskussionen) um Susan Stahnkes Nacktfotos in einer September-Ausgabe
der Bild-Zeitung und zu dem Kommentar eines tagebuchartigen
Weblogeintrags einer Schweizer Bloggerin, die von ihrer Mutter Unterwäsche
zum Geburtstag geschenkt bekommt. Man kann natürlich über die Wichtigkeit
dieser Bezüge für eine philologische Lektüre von Madame Bovary streiten, zumal ja die
traditionelle Kommentierung ohnehin keine Aktualisierung, sondern nur
zeitgenössische bzw. sogar dem kommentierten Text chronologisch
vorausliegende Daten zulässt. Geht es umgekehrt aber, wie ich zu Beginn
dieses Beitrags angeregt habe, um die Archäologie der Stellung von
Literatur in der Gegenwartskultur, so scheint mir dieses unvermittelte,
collageartige Nebeneinander von Arten, über Erotik zu sprechen, durchaus
aufschlussreich – es gehört meiner Meinung aufgrund der Heterogenität des
verwendeten Materials zu den interessantesten ästhetischen
Überraschungseffekten, die die Kommentarpraxis in Weblogs hervorrufen
kann.
2.3 Weblogs und Selbstpraxis
Abschließend soll die Frage aufgeworfen werden, ob es ausreicht,
Weblogs mit Hartmut Winkler allein im Hinblick auf ihre
Verdichtungsfunktion im Rahmen eines kollektiven Gedächtnisses zu
untersuchen, oder ob es nicht in Wechselwirkung damit auch um die Formierung individueller Subjektivität geht, was zur
Untersuchung von schreibenden Selbstpraktiken hinführt. Schon die
chronologische Anordnung von Einträgen in Weblogs ruft eine Form der
Verschriftlichung auf, die mit der philologischen Kommentartradition im
engeren Sinn, von der ich ausgegangen war, nicht mehr kompatibel
erscheint, nämlich die Tradition der Notiz- und Tagebücher.
Erweitert man jedoch das Spektrum kommentierender Texte von der
philologischen Tätigkeit im engeren Sinn auf Grenztexte, die sich wie z.B.
Montaignes Essais des Kommentars in mehr oder weniger direkter
autobiographischer Absicht bedienen, so sieht man, wie sich
Selbstverschriftung zumindest als Möglichkeit immer schon über Kommentare
konstitutiert, wie auch umgekehrt Kommentarstrukturen meist die
Möglichkeit eines Umschlags in Selbstverschriftung offenhalten. Dies wird
nicht nur in der frühen Neuzeit, sondern auch am Beispiel der Weblogs
praktiziert. Wie Foucault in seinem bekannten Aufsatz "L'écriture de soi"
(Foucault 1994)
darstellt, geht es bei schreibenden Selbstpraktiken um Modi der Aneignung
von häufig disparaten fremden Diskursen und Gedanken durch
Zusammenführung zu einem Konvolut von Notizen – die so genannten
Hypomnemata, die seit der Spätantike eine philosophische Übung der
Selbstsammlung darstellen. Diese Übung besteht nicht nur in einer
expliziten Selbstthematisierung des Subjekts als Objekt seiner eigenen
Gedanken, sondern beruht noch grundlegender auf einer – bereits eingangs
von Gumbrecht ins Spiel gebrachten – 'schwachen' Subjektivität im Sinn
einer unablässigen Tätigkeit des Sammelns und Wiederholens von fremdem
Diskursmaterial, das man sich durch wiederholten Umgang sozusagen aneignet.34
PhiN-Beiheft 2/2004: 51
Was die Disparatheit der durch Notizen angeeigeneten Fragmente
betrifft, so eröffnet das Internet als Universum, in dem zunächst noch
relativ unverdichtet alle möglichen Texte zusammenlaufen, beim Ausstellen
von Fragmenten, die vom Sammler in eine irgendwie sinnträchtige Beziehung
gesetzt werden sollen, eine enorme Herausforderung. Wenn man dafür
wiederum den Sofa blogger alias Peter Praschl als Ausgangspunkt nimmt,
gelingt es ihm jedenfalls, zwischen Themen wie Nacktphotos eines
Möchtegern-TV-Promis in der Bildzeitung und den romantischen
Evasionsträumen einer Romanheldin aus dem 19. Jahrhundert eine nicht
explizit gemachte, dennoch aber suggestive Beziehung herzustellen.
Als Selbstpraktiken haben Weblogs natürlich immer auch eine
exhibitionistische Seite, ob sie nun als explizite Tagebücher geführt
werden oder nicht. Auch das ist in der Geschichte von Subjektivität nach
Foucault vorgezeichnet: Aus der spätantiken Konstitution eines
Selbstverhältnisses haben sich durch Zwischenschaltung einer
externalisierten 'dritten' Instanz im Laufe der Subjektgeschichte das
Beichtdispositiv, wo die Selbstsammlung der Rechenschaft gegenüber einem
directeur spirituel weicht, sowie das psychoanalytische
Gesprächsdispositiv entwickelt, wo der Beichtvater durch den Therapeuten
ersetzt wird. In letzter Zeit gibt es Überlegungen, die Geschichte des
Beichtdispositivs noch weiter in die Gegenwart zu verlängern, und zwar auf
Fernsehtalkshows als Beichtsupplemente, wobei die wahrheitsproduzierende
Kontroll- bzw. therapeutische Normalisierungsinstanz, die das beichtende
Subjekt formiert, durch die Rollenfunktionen des Talkmasters sowie der
Fernsehzuschauer übernommen wird.35 Es stellt
sich allerdings die Frage, ob es nicht neben dieser Formierung von
Subjektivität im starken Sinn auch mediale Aufzeichnungsformen gibt, die
keine Subjektivierung in Form einer Unterwerfung unter ein performatives
Fernsehurteil bedeuten,36 sondern ihm
vielmehr eine – bei aller symbolischen Einbeziehung einer beobachtenden
Kontrollinstanz – distanziertere, 'schwächere' Konstitution und Moderation
seiner selbst ermöglichen. Die Freigabe eigener Notizen für die Kommentare
einer mehr oder weniger uneingeschränkten Leserschaft im WWW in Weblogs
scheint dafür prädestiniert, einen spannungsreichen und hinreichend
komplexen Spielraum für Subjektkonstitution zu eröffnen, ohne den
Außenbezug zum imaginären Substitut eines die symbolische Ordnung
repäsentierenden Außen ganz abzuschaffen.37 Dieser
Spielraum wird dadurch konstitutiert, dass sich der Blogger
zwar relativ unmittelbar seinen Lesern als einer äußeren Kontrollinstanz
öffnet, aber über die performative Selbstverhältniskonstruktion in
Talkshows hinaus, die zwar aufgezeichnet, aber in der Regel nicht
nachträglich 'korrigiert' werden kann, eine prozesshafte Möglichkeit zum Eingriff in die
Kommentierung seiner eigenen Aussagen hat. Die mediale Praxis 'Weblog'
gewinnt hier eine eigene Dichte, die dem Blogger eine Ausfaltung seiner
Selbstpraxis in einer geregelten zeitlichen Dauer ermöglicht.
Außerdem geht es bei der Subjektkonstitution via Weblog bei weitem
nicht nur um die explizite Thematisierung des mehr oder weniger
stilisierten oder in bestimmter Weise narrativ auf Kohärenz oder Spannung zugerichteten Lebens,38 selbst wenn einige Weblogs keineswegs
linkorientiert sind, sondern als elektronische Tagebücher geführt werden.
Interessanter für die Frage nach Subjektkonstitution scheinen mir jedoch
gerade die Weblogs, in denen es nicht explizit um das eigene Ich in den
Facetten Alltag, Beruf, Hobbys und Sex geht, sondern um indirekte
Selbststilisierung durch die Auswahl und Art der Kommentierung der
Einträge.
Es sei hier abschließend noch ein weiteres Mal gestattet, auf den
Sofa blogger zurückzukommen.39 Das
(inzwischen leider abgelöste) Motto des Sofa (vgl. Abb. 6)40 verweist
bereits auf eine bestimmte Tradition der Selbstkultur, die von der
französischen, selbsterkenntnisskeptischen Moralistik des 17. Jahrhunderts
bis in die literarische Moderne reicht, wenn Praschl mit einem Zitat aus
Paul Valérys Cahiers die nötigen Umwege in der Erforschung der
eigenen Subjektivität herausstellt: "Il faut entrer en soi-même armé
jusqu'aux dents."41
PhiN-Beiheft 2/2004: 52
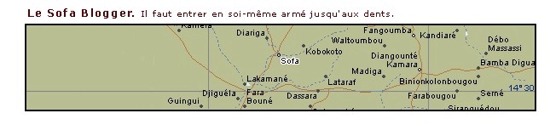
Abb. 6: Das alte Motto des Sofa (http://sofa.digitalien.org/sofablog/what.html, 25.9.03)
Die Arbeit am eigenen Subjekt findet auf dem Sofa, mit Pierre Bourdieu
gesprochen (vgl. Bourdieu
1979), als Distinktionsgewinn durch Stilisierung des eigenen und
ironische Kommentierung fremden Geschmacks statt. Demonstrieren lässt sich
das zum Beispiel an einem (für Weblogs ungewöhnlich langen) Eintrag, den
Praschl am 18. Juni 2003 postet und in dem die Geschichte von Weblogs als
Geschichte des Punk erzählt wird – entscheidend ist, dass Praschl, der
beruflich als Textredakteur bei der Frauenzeitschrift Amica tätig
ist, die Geschichte von Weblogs bei aller ironischer Brechung als, wie er
selbst schreibt, durchaus pathetisch gemeinte 'mystifizierende' Geschichte
vom Aufstieg und Fall einer Szenebewegung, eines "arschcoolen heißen
Dings", erzählt.
|
Verschwende deine Jugend (7'' inch demo).
Heute darüber nachgedacht, ob die Geschichte von Weblogs sich so
ähnlich erzählen (was durchaus mystifizieren heißt) ließe wie die
Geschichte von Punk. Ein paar merkwürdige Typen, die bei sich zu
Hause auf billigen Instrumenten schnell ein paar dreckige Seiten
zusammenhauen. Kurze Sachen, von denen man nicht so genau weiß, was
sie sollen. Keine Regeln. Hört sich oft nicht gut an, hört sich aber
rauh an, hört sich cool an, hört sich scheißdrauf an. Nicht wie die
großen Bands mit ihren ewigen Konzeptalben, die immer größer werden,
immer virtuoser, immer selbstverliebter. Nicht wie dieses Posertum
der großen Bands, die begonnen haben, Dreifachalben zu machen mit
ekeligen Hipgnosis-Covern, eigene Welt sein wollen, Jünger machen,
die nicht zu anderen Bands gehen. Nicht wie die großen Bands, die
Leadgitarristen haben, die sich fünfzehn Minuten einen abwedeln auf
irgendwelchen Sonderanfertigungen, dauernd neue Instrumente
erfinden, die viel zu teuer sind für die Kids da draußen und die man
eigentlich nur auf High-End-Stereoanlagen hören dürfte mit
Goldkabeln zwischen Verstärker und Vorverstärker, klar, die brauchen
auch noch einen Equalizer, aber immer kommt nur öder langweiliger
Müll dabei heraus. Die Garagenkids sind anders. Zum Beispiel
deswegen, weil sie einander mögen, weil sie lieber gemeinsam in
irgendeiner versifften Klitsche auftreten als im Hammersmith. Das
Repertoire würde ja eh nicht reichen für ein eigenes Konzert, gerade
mal vier Dreiminutenhämmer im Repertoire, außerdem haben vier Bands
zusammen nur drei Snare Drums, da muss man einander aushelfen, und
das Wichtigste ist eh das Nichtalleinesein. Dass man viele ist.
Nicht vier Millionäre, die einander nicht leiden können, aber alle
achtzehn Monate sich für ein doofes Album ein paar Wochen lang in
einem dieser Peter Wolf-Studios oder auf Mustique einkasernieren.
Sondern viele. Lauter Leute, die AOL-T-Shirts anhaben, und AOL ist
durchgestrichen und drüber steht KILL. Und die Abende sind magisch.
Es wird viel gesoffen, viel durcheinandergepudert, viel
herumgestritten, viel auf der Stelle gesprungen, und es fühlt sich
so intensiv an. Wie die Stimme von Johnny Rotten. Zugeschliffene
Eckzähne. Geht gut los, das.
PhiN-Beiheft 2/2004: 53
Irgendwann kriegen die anderen das mit. Noch mehr Kids da
draußen, die sich jetzt auch alle so ein Weblog zulegen wollen,
obwohl sie gar nicht kapieren, was das ist und worum es geht. Sie
haben es halt mitbekommen, dass dort ein guter Sound ist und die
irrsten Leute miteinander können, und wenn man Glück hat, gibt es
Gigs, bei denen jeder jeden linkt. Das wollen sie auch haben. Obwohl
sie doch bisher immer nur im Proberaum der evangelischen
Jugendgemeinde in so einer Covercombo gespielt haben, das
Megabandrepertoire rauf und runter, sogar Kuschelrock. Schmeißen sie
alles weg jetzt, schneiden sich die Haare, kaufen sich auch so ein
wildes T-Shirt (die gibts nämlich jetzt schon zu kaufen) und
probieren es mit Punk. Aber man hört das noch, dass die früher
Kuschelcovers gemacht haben. Manchmal spielt sogar einer
Klampfenelsen-Folk, nur ein bisserl schneller. Klingt dann fast wie
Punk.
Die Typen, die das losgetreten haben, können nicht mehr. Guck dir
die an, denken sie, ein bißchen Wetgel von Stustustudioline aufn
Kopf und sie glauben, das reicht schon. Arschlöcher. Kriegen gleich
was in die Fresse. Musst du dir erst verdienen, ein Punk zu sein.
Ein paar Punks sind übrigens bald gestorben. Eines Morgens: nicht
mehr da. Einfach weg. Weiß keiner, wo sie geblieben sind. Im
Google-Cache spuken sie noch ein wenig, aber irgendwann sind sie
vergessen. Nur ein paar Veteranen kennen ihre Namen noch.
Selber Arschlöcher, sagen die Kids. Obwohl sie ein schlechtes
Gewissen haben, manchmal. Wir machen jetzt, sagen sie, New Wave. Das
hört man auch. Geht gar nicht anders, sie haben ja jahrelang in der
evangelischen Jugendgemeinde gespielt. Sind anders drauf. Zum
Beispiel nicht so viel Hass. Machen jetzt Spaßpunk. Machen sowieso
lauter neue Abteilungen auf. Neue deutsche Welle. New Romantics mit
Liebeskummereinträgen und Gedichten und so Zeug. Ein paar davon sind
gut, die meisten nicht einmal One-Hit-Wonder. Na ja.
Dann gibt es da noch die Meta-Punks. Die die Gesten
dekonstruieren, irgendwie rumspielen mit den Images, sich permanent
tarnen und enttarnen. Typische Kunsthochschüler eben, aber nicht
uninteressant. Leute mit französischen Namen oder so Fremdwörtern,
Anspielungen. Funktionale Gruppe, Le Sofa, Amor Oscuro Flagship
Store, Camp Catatonia. Komisches Zeug, was die machen, Sonderlinge,
kann nicht jeder mit, auch die Altpunks nicht, aber man weiß
voneinander, irgendwie sind wir doch Geschwister.
Irgendwann kommen auch die Organisierer. Bauen alternative
Vertriebswege, Vernetzung, Szene Szene. Lauter neue Indie-Labels.
Alles selbstgemacht. Klingt gut. Manchmal. Und manchmal klingt es
auch so öde nach Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme. Und wir wollten
doch den ganzen Scheiß nicht haben, Arbeit, Beschaffung, Maßnahme,
Lion's Club, Old Boys Netzwerk, Geschäftsmodelle. Und wer hat hier
eigentlich den Glam – die Typen, die auf der Bühne stehen oder die
Typen, die das Programmheft für den Club schreiben? Ein paar davon
sind übrigens schwer in Ordnung. Man liebt sie. Kaum zu glauben, wie
sie den Ratinger Hof immer noch am Leben halten. Haben wir
eigentlich gar nicht verdient, so oft, wie wir den Laden zerdeppert
haben.
PhiN-Beiheft 2/2004: 54
Schließlich: die Corporate Rock Bosse. Guckt euch da mal um,
sagen sie zu ihren Scout-Knechten. Da gibt's ein paar Leute in den
Unterstadtclubs, die sollten wir nicht verpassen. Heuert mal ein
paar von denen an. Wenns klappt, kommen wir groß raus, wenn nicht,
auch kein Verlust. Die Dieter Gornys also. Hey, bei uns könnt ihr
machen, was ihr wollt. Euer Video wird übrigens von Dolezal &
Rossacher gedreht. Die haben schon die Videos von den Stones
gemacht, ganz dufte knorke Kumpel, sieht vielleicht ein wenig
komisch aus auf den ersten Blick für euch, aber daran gewöhnt ihr
euch schon. Ja, da läuft unser Senderlogo immer mit bei euren
Videos, mittelbündiges Banner oben, aber dafür kümmern wir uns um
alles. Und jetzt macht mal. Das Copyright liegt übrigens bei
uns.
Ganz am Ende: ein paar ältliche Zausel in der Fußgängerzone. Zu
fertig, um es noch zu bringen. Alte abgewetzte Lederjacken,
irgendeine Misttöle, ein paar Dosen Bier. Aber immer noch ein
schöner Iro. Echt Kernseife, kein Gel. Du gehst vorbei und kannst es
kaum glauben, dass es die Typen immer noch gibt. Glotz nicht so,
zischt dir einer nach, wenn du fotografieren willst, musst du
löhnen. (Praschl
2003) |
Der Popkulturvergleich – die Reaktionen auf Praschls Eintrag zeigen es
– trifft und reflektiert offensichtlich ziemlich genau das
Selbstverständnis der Leser des Sofa blogger: Bloggen wird als Abgrenzung
gegenüber anderen Internet-Nutzern begriffen – wo diese Abgrenzung nicht
mehr über bestimmte Verhaltensweisen funktioniert, hilft nur noch die
ironische Selbstdistanzierung von dem, was inzwischen alle machen. Wie
genau die verschiedenen Formen der Selbststilisierung in der Weblog-Szene
nun auch aussehen mögen, sie stellt wohl jedenfalls eine mehr oder weniger
unumgehbare Taktik der Bewältigung ausufernder Diskursvielfalt durch
Selbstdistinktion dar – eine Taktik, die bis mindestens zum Dandytum des
ausgehenden 19. Jahrhundert zurückreicht, das bspw. Foucault als eine Form
des Wiederauflebens von Selbstpraktiken in der Moderne ansieht.42
3 Ausblick
Besonders der letzte Gedankengang zu den subjektkonstitutiven
Implikationen hat scheinbar weit vom Ausgangspunkt der Argumentation,
nämlich dem Verhältnis von 'geschlossenem' philologischem und 'offenem'
kulturellen Kommentar weggeführt. Damit ist die eingangs als Aufhänger
verwendete These von Gumbrecht, der zufolge das Internet eigentlich die
Fortsetzung des philologischen Kommentars mit anderen Mitteln betreibt,
zumindest stark relativiert. Interessant ist aber als abschließender
Rückbezug, dass es im Vergleich der beiden Kommentarformen so etwas wie
eine Dialektik von Offenheit und Geschlossenheit zu geben scheint: Der
philologische Kommentar setzt in seinen momentan avanciertesten
Formen meist auf die 'entgrenzenden' Möglichkeiten elektronischer
Hypertexte und im Extremfall sogar auf die Verfügbarmachung und Vernetzung
von kommentierten Text-Universen im Internet (vgl. z.B.
Hoffmann / Jörgensen / Foelsche 1993). Umgekehrt reduzieren Weblogs teilweise
recht brachial die Fülle der im Netz verfügbaren Texte auf die Standards
ihrer Diskursgemeinschaft. Während also der philologische Kommentar in
seinem geschützten Umfeld am Abbau von Hierarchien arbeitet, sind Weblogs
mit ihrer Aufrichtung beschäftigt.
PhiN-Beiheft 2/2004: 55
Vielleicht könnte eine Vermittlung zwischen den beiden divergierenden
Kommentarpraktiken einstweilen in der Empfehlung für die romanistische
Literaturwissenschaft43 bestehen, Weblogs verstärkt als Werkzeug der
philologischen Arbeit, sei es in der Lehre oder in der Forschung
einzusetzen. Dies bedeutet natürlich zunächst eine Domestizierung der
prinzipiellen Spielräume der Weblog-Praxis, die ich hier versucht habe
auszuloten. Vielleicht ist aber diese strukturelle Einschränkung unter
verstärkter Heranziehung von nicht im Internet
stehenden Texten als Objekt von Kommentaren auch mit einer Chance zur
semantischen Anreicherung der Kommentare verbunden.
Ich selbst bin nach einem inzwischen fast ein halbes Jahr dauernden
Selbstversuch als Weblog-Betreiber recht zuversichtlich, dass die
Versuchung für den Philologen, vorsichtig tastende und mit vertrautem
Theoriebestand abgesicherte Jagdzüge in die Weiten der Netzdiskurse zu
unternehmen, um sich neue topics anzueignen und sie in Verbindung
mit 'klassischen' Texten zu setzen, weder persönlich noch wissenschaftlich
schaden kann – die Angst, sich dabei im Cyberspace auf Nimmerwiedersehen zu
verlieren, sollte ja eigentlich allmählich überwunden sein.
Postscriptum (Anfang 2004)
Selbst im Abstand von wenigen Monaten zu den Weblog-Texten, auf die ich
hier eingegangen bin, wird deutlich, dass dieser Beitrag zu Weblogs,
abhängig von den neuesten Diskussionen, die dort seitdem geführt werden,
heute wohl schon wieder ganz anders aussehen könnte.44 Und nicht
nur innerhalb der 'Blogosphere' wird sich in einigen Monaten wieder
einiges verändert haben, sondern auch das Bloggen überhaupt als
derzeitiges Modephänomen der Netzkultur wird in einigen Jahren entweder in
größere Anwendungszusammenhänge integriert oder vielleicht auch weitgehend
aus der allgemeinen Aufmerksamkeit verschwunden sein.
Das alles stellt natürlich die Frage nach dem Sinn einer
wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Bloggen, zumal in einer
Perspektive des Kommentars, dem es ja, wie oben ausgeführt, nicht zuletzt
um kulturelle Traditionsbildung geht. Hierzu an dieser Stelle nur folgende Bemerkungen:
Die Art der Publikation des Beitrags zielte darauf, den Bezug von
verschiedenen Kommentarpraktiken innerhalb und außerhalb der Philologie
nicht nur theoretisch zu postulieren, sondern auch praktisch durch Nutzung
verschiedener etablierter Kommunikationswege durchzuführen. Dadurch, dass
der Beitrag parallel am Romanistentag vorgestellt und in meinem Weblog zur
Diskussion angeboten wurde, sollten zwei verschiedene
Diskursgemeinschaften, eine wissenschaftliche und eine 'bloggende',
gleichzeitig angesprochen werden. Die Reaktionen darauf waren verhalten,
sodass ich inzwischen bezüglich der Möglichkeit eines wirklichen
Austausches zwischen akademischer und nichtakademischer Kommentartradition
etwas skeptischer geworden bin.45 Das liegt
nicht so sehr an den Reaktionen seitens der Weblog-Szene, als dieser
Beitrag in meinem eigenen Weblog zur Kommentierung freigegeben wurde.46 Es liegt vielmehr daran, dass die
institutionalisierte Wissenschaft, insbesondere die Philologie, bis auf
wenige Ausnahmen47 mit gänzlich anderen, derzeit vor allem noch
printorientierten Rezeptionswegen arbeitet und in anderen, längerfristigen
Rezeptionszyklen denkt.
PhiN-Beiheft 2/2004: 56
Wahrscheinlich ist dies einfach eine Frage der
kommunikativen Ökonomie innerhalb jeder Disziplin und spricht nicht für
eine besondere Phobie gegenüber Neuen Medien innerhalb der deutschen
Romanistik. Um so etwas wie einen Dialog über die Grenzen akademischer
Institutionalisierung hinweg zu versuchen, müssen wohl parallele
Kommunikationsstrategien entwickelt werden, die verschiedenen diskursiven
Traditionen gerecht werden und zumindest fallweise auch verschiedene
Publikations- und Rezeptionsgeschwindigkeiten miteinander kurzzuschließen
versuchen. Das Ziel müsste darin bestehen, einerseits möglichst zeitnah zu
publizieren und die langsam mahlenden Mühlen wissenschaftlicher
Sammelveröffentlichungen durch Veröffentlichung im Internet abzukürzen, d.h.
für aktuelle Themen mit relativ kurzen Halbwertszeiten auch ein
'schnelles' Medium zu wählen. Andererseits müssten solche Publikationen
dennoch in Fachkreisen rezipiert werden – eine erste Entwicklung in diese
Richtung sind Online-Zeitschriften, die, wie Philologie im Netz,
eine relativ klassische Präsentationsform wissenschaftlicher Texte gewählt
haben. Längerfristig stellt sich natürlich die Frage, ob bzw. wie sich
durch das Publizieren im Netz das wissenschaftliche Schrifttum überhaupt
verändern wird.48
Doch auch im günstigsten Fall einer Rezeption dieses Beitrags
innerhalb der institutionalisierten akademischen Diskussion stellt sich
die weitere Frage nach dem Ort einer so aktualitätsgebundenen
Untersuchung. Kann dieser Beitrag – eine gewisse Dauer der Internetpräsenz
dieser Akten vorausgesetzt49 – überhaupt
noch von Interesse sein, wenn der Untersuchungsgegenstand 'Weblogs'
einmal in nicht allzu ferner Zeit marginal oder selbstverständlich
geworden ist oder sich in eine ganz andere, möglicherweise stärker
bildorientierte und somit ganz 'unphilologische' Richtung entwickelt hat
als dies von meiner heutigen Perspektive aus abschätzbar war? Schon heute
mutet es ja durchaus seltsam an, die euphorische, aber kurzlebige
Diskussion um Hypertextualität aus den neunziger Jahren50 nachzuvollziehen, obwohl sich noch vor
einigen Jahren offensichtlich kaum jemand, der sich mit dem Thema
beschäftigt hat, der euphorischen Einschätzung entziehen konnte, die
Zukunft der Literatur läge in erster Linie in den Netzen.
Ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma wäre der, den der im Artikel
mehrfach zitierte Medienwissenschaftler Hartmut Winkler gewählt hat,
nämlich seinen Beiträgen 'Verfallsdaten' zuzuweisen, die einer geschätzten
Aktualität des behandelten Themas entsprechen, und die Beiträge
konsequenterweise nach diesem Datum dem öffentlichen Zugang zu entziehen.
Ich vertraue jedoch hier eher auf die 'automatischen' Selektionsleistungen
des kulturellen Gedächtnisses im Zeitalter des Mediums Computer: Die
Wahrscheinlichkeit, dass diese Ausführungen in ein paar Jahren nicht mehr
relevant sind, ist – realistisch betrachtet – ziemlich groß. Dennoch
scheint es mir sinnvoll, die prinzipielle Zugriffsmöglichkeit auf Beiträge
wie diesen möglichst lange sicherzustellen. Das ist das letzte Stück
Netzutopie, das ich mir gestatte: Es geht um das Interesse,
mediengeschichtliche Momentaufnahmen für einen derzeit noch nicht
vollständig absehbaren Zweck zu archivieren.51 Vielleicht
werden sie ja nach Verlust ihres unmittelbaren Gebrauchswerts einmal mit
einem heute noch nicht kalkulierbaren medienhistorischen Tauschwert
ausgestattet.
PhiN-Beiheft 2/2004: 57
Bibliographie
Assmann, Jan (1995):
"Text und Kommentar: Einführung", in: Ders. / Burkhard Gladigow (Hg.):
Text und Kommentar. München: Fink, 9–33.
Benjamin, Walter
(1991): Das Passagen-Werk: Gesammelte Schriften V, hg. von Rolf
Tiedemann / Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt/M.: Suhrkamp (2
Bde.). [1935]
Bohnenkamp, Anne
(1997): "Textkritik und Textedition", in: Heinz Ludwig Arnold / Heinrich
Detering (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: dtv,
179–203.
Borsò, Vittoria (Hg.)
(2001): Medialität und Gedächtnis: Interdisziplinäre Beiträge zur
kulturellen Verarbeitung europäischer Krisen. Stuttgart: Metzler.
Bourdieu, Pierre
(1979): La distinction: Critique sociale du jugement. Paris:
Minuit.
Burg, Thomas N.
(2003): "Weblogs: Next generation Webpublishing", in: Randgänge
[Weblog: http://randgaenge.net/stories/2003/09/21/weblogsNextGenerationWebpublishing.html,
23.9.2003].
Butler, Judith
(1997): The Psychic Life of Power: Theories in Subjection.
Stanford: Stanford UP.
Cehpunkt (Pseud.)
(2003): "Das Private wird öffentlich", in: Generation blogger
[Weblog: http://bloggern.de/archives/week_2003_07_06.html,
11.7.2003].
Chervel, Thierry
(2003): "Fallende Blätter: Das deutsche Feuilleton aus der Perspektive des
Internet", in: Perlentaucher [http://www.perlentaucher.de/artikel/1117.html,
20.9.2003].
Dünne, Jörg (2003):
Asketisches Schreiben: Rousseau und Flaubert als Paradigmen
literarischer Selbstpraxis in der Moderne. Tübingen: Narr.
Dünne, Jörg
(2003a): "Weblogs und der Wandel des Publizierens im Netz". Vortrag in
Basel im Rahmen der Vorlesung Theorie und Geschichte der Medien von
Prof. G.C. Tholen [Schriftfassung unter http://romblog.twoday.net/stories/106550/,
2.12.2003].
Eigner, Christian
(2002): "Wenn Medien zu oszillieren beginnen", in: Lettre
international 59, 109–110. Im Internet auch in: Texte zur
Wirtschaft – Blogging und die neue Medienkultur des Netzes [http://www.tzw.biz/www/home/article.php?p_id=2029,
23.9.2003].
Featherstone, Mike
(1998): "The Flâneur, the City and Virtual Public Life", in:
Urban Studies 35/5–6.
Foucault, Michel
(1971): L'ordre du discours. Paris: Gallimard.
Foucault, Michel
(1976): La volonté de savoir: Histoire de la sexualité 1.
Paris: Gallimard.
Foucault, Michel
(1994): "L'écriture de soi", in: Ders.: Dits et écrits, hg. von
Daniel Defert / François Ewald. Paris: Gallimard, Bd. 4, 415–430.
[1983]
PhiN-Beiheft 2/2004: 58
Genette, Gérard
(1982): Palimpsestes: La littérature au second degré. Paris:
Seuil.
Google Technology
(2003): "Our Search" [http://www.google.com/technology/,
23.9.2003].
Grésillon, Almuth
(1998): "Literarische Handschriften im Zeitalter ihrer technischen
Reproduzierbarkeit. Von der Mimesis zur Simulation", in: Andreas Kablitz /
Gerhard Neumann (Hg.): Mimesis und Simulation. Freiburg: Rombach,
255–275.
Gumbrecht, Hans
Ulrich (2003): Die Macht der Philologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Heidegger, Gerald
(2003): "Bloggen im 18. Jahrhundert", in: Telepolis [http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/15601/1.html,
15.9.2003].
Heidegger, Gerald
(2003a): "Karl Kraus und die Blogger", in: Telepolis [http://www.heise.de/tp/deutsch/special/med/15906/1.html,
6.11.2003].
Hoffmann, Dirk /
Jörgensen, Peter / Foelsche, Otmar (1993): "Computer-Edition statt
Buch-Edition. Notizen zu einer historisch-kritischen Edition – basierend
auf dem Konzept von hypertext und hypermedia", in:
editio 7, 211–220.
Kantel, Jörg
(2002): "Archäologie des Bloggens", in: Texte zur Wirtschaft – Blogging
und die neue Medienkultur des Netzes [http://www.tzw.biz/www/home/article.php?p_id=2028,
23.9.2003].
Kantel, Jörg (2003
[update 9.9.]): "Was ist RSS?", in: Schockwellenreiter [Weblog: http://www.schockwellenreiter.de/webdesign/rss.html,
23.9.2003].
König, Thomas (2003):
"Weblogs – was sie sind und was sie können. Eine kleine Bestandsaufnahme",
in: Malmoe on the web – Topstories [http://www.malmoe.org/artikel/top/518,
20.9.2003].
Krämer, Sybille
(2000): "Das Medium als Spur und als Apparat", in: Dies. (Hg.): Medien
– Computer – Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue
Medien. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 73–94.
Krüger, Alfred
(2003): "Massensterben bei den Blogs?", in: Telepolis [http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/on/15849/1.html,
15.10.2003].
Landow, George P.
(1997): Hypertext 2.0. Baltimore: Johns Hopkins UP.
Lejeune, Philippe
(2000): "Cher écran...": Journal personnel, ordinateur, Internet.
Paris: Seuil.
Lüdeke, Roger [o.J.]:
"Kommentar", in: Kompendium der Editionswissenschaften [http://www.edkomp.uni-muenchen.de/CD1/C/Kommentar-C-RL-print.html,
20.9.2003].
PhiN-Beiheft 2/2004: 59
Mosel, Stephan
("Moe") (2003): "Über den Einsatz von Weblogs in institutionalisierten
Lernprozessen [mit Kommentaren]", in: Bildungsblog [Weblog: http://bildung.twoday.net/stories/5022/,
23.9.2003].
Most, Glenn W. (Hg.)
(1999): Commentaries. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
Neumann, Gerhard /
Weigel, Sigrid (Hg.) (2000): Lesbarkeit der Kultur:
Literaturwissenschaften zwischen Kulturtechnik und Ethnographie.
München: Fink.
Porombka, Stefan
(2001): Hypertext: Zur Kritik eines digitalen Mythos. München:
Fink.
Praschl, Peter
[o.J.]: "What th f**ck is Le Sofa Blogger? / What th f**ck is a
weblog?", in: Le sofa blogger / Sofa: A Virtual Hangout [Weblog: http://sofa.digitalien.org/sofablog/what.html].
Praschl, Peter
(2003): "Verschwende deine Jugend (7'' inch demo)", in: Sofa
[Weblog: http://arrog.antville.org/stories/420423/,
23.9.2003].
Praschl, Peter
(2003a): "Das einzige Problem der Madame Bovary...[und Kommentare]", in:
Sofa [Weblog: http://arrog.antville.org/stories/515249/,
16.9.2003].
Reuß, Roland (2000):
"Vom letzten zum vorletzten Wort: Anmerkungen zur Praxis des
Kommentierens", in: Textkritische Beiträge 6, 1–14.
Stierle, Karlheinz
(1990): "Les lieux du commentaire", in: Gisèle Mathieu-Castellani /
Michel Plaisance (Hg.): Les commentaires et la naissance de la
critique littéraire. Paris: Amateurs de livres, 19–30.
Supatyp (Pseud.)
(2003): "Internetz 1 – Feujetong 0", in: Supatyp – außen Topics, innen
Geschmack [Weblog: http://mark.antville.org/stories/520973/,
25.9.2003].
Tholen, Georg
Christoph (2002): Die Zäsur der Medien. Kulturphilosophische
Konturen. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Tobi (Pseud.) (2003):
"Petition für ein Ende der privaten (ie. non-public) Weblogs auf
Antville.org [und Diskussion]", in: Toblerone [Weblog: http://tobi.antville.org/stories/380524/,
13.5.2003].
Walker, Jill (2003):
"Final Version of a Weblog Definition", in: jill/txt [Weblog: http://huminf.uib.no/~jill/archives/blog_theorising/final_version_of_weblog_definition.html,
28.6.2003].
Winer, David (2002
[update]): "The History of Weblogs", in: Weblogs.com
[Weblogverzeichnis: http://newhome.weblogs.com/historyOfWeblogs,
20.9.2003].
Winkler, Hartmut
(1997): Docuverse. Zur Medientheorie der Computer. München:
Boer.
PhiN-Beiheft 2/2004: 60
Winkler, Hartmut
(1997a): "Von Pull zu Push", in: Telepolis [auch unter: http://www.uni-paderborn.de/~winkler/push.html,
20.9.2003].
Winkler, Hartmut
(2003): "Medium Computer" [Vortrag in der Reihe Understanding New
Media, Nixdorf-Forum Paderborn; http://www.uni-paderborn.de/~winkler/compmed2.html,
20.9.2003].
Zeglovits, Wolfgang
(2003): "Quo vadis Weblog", in: Malmoe on the web – Erlebnispark
[http://www.malmoe.org/artikel/erlebnispark/535,
20.6.2003].
Übersicht über im Artikel erwähnte Weblogs
2 oder 3 Dinge, die wir über Weblogs wissen [http://convers.antville.org/]
Bildungsblog [http://bildung.twoday.net/]
Confessional virtuel (französisch) [http://joueb.com/confessionnal/]
efimera (spanisch) [http://www.efimera.org/]
Erratika [http://www.erratika.de/]
Ethno::log [http://sonner.antville.org/]
generation blogger [http://www.bloggern.de/]
IfThenElse (portugiesisch) [http://www.asseptic.org/blog/]
L'œil de mouche (französisch) [http://mouche.joueb.com/]
Mimima moralia (Adorno-Lektüregruppe, zugangsbeschränkt) [http://empire.antville.org/].
Mosaikum [http://www.mosaikum.org/]
owrede_log (Persönliches Weblog von Oliver Wrede von der FH Aachen)
[http://weblogs.design.fh-aachen.de/owrede/]
Randgänge [http://randgaenge.net/]
Romblog [http://romblog.twoday.net/]
Sofa (Le Sofa Blogger) [http://arrog.antville.org/]
Toblerone [http://tobi.antville.org/]
Wasted Comments Dump [http://commentsdump.antville.org/]
PhiN-Beiheft 2/2004: 61
Weitere erwähnte Internet-Links zum Thema "Weblogs"
Antville [Kostenloser Anbieter mit eigenem Server (z.Zt. belegt)
und eigener Software: http://www.antville.org/]
Blogger [in Grundversion kostenloser Anbieter mit eigenem Server:
http://www.blogger.com/]
Blogoo [Weblogsuchmaschine, Entwicklung inzwischen eingestellt: http://www.blogoo.de/]
Blog Project [Weblogserver der Universität Stanford: http://www.stanford.edu/dept/itss/projects/blog/]
Blogtalk [Internationale Weblogtagung in Wien im Mai 2003 (Fortsetzung im Juli 2004),
organisiert von Thomas N. Burg: http://www.blogtalk.net/]
Fachbereich Design der FH Aachen [Seminarweblogs auf Initiative von
Oliver Wrede: http://seminare.design.fh-aachen.de/]
Fakultät Medien an der Uni Weimar, Weblogserver [Fakultätseigener
Weblogserver mit Antville-Software: http://antville.medien.uni-weimar.de/]
Internet Archive [http://www.archive.org/]
Movable Type [in Grundversion kostenlose Software zum Betrieb auf eigenem Server:
http://www.movabletype.org/]
Nitle Weblog Census [Weblogverzeichnis, das weltweite Weblogzahl zu
erfassen versucht: http://www.blogcensus.net/]
Personal Web Publishing Systeme und Weblogs [Medienpädagogisches
Seminar der Uni Augsburg im WS 2003/04 unter Leitung von Sebastian
Fiedler, http://personalwebpublishing.mediapedagogy.com/]
Radio Userland [Kostenpflichtige Software, auf Wunsch mit
Servernutzung: http://radio.userland.com/]
Seminar-Weblogs des Fachbereich Design der FH Aachen [http://seminare.design.fh-aachen.de/]
Twoday.net [Kostenpflichtiger Anbieter mit eigenem Server (Ableger
von Antville): http://www.twoday.net/]
Weblogs.com [Weblogverzeichnis, unterhalten von Davis Winers Firma
Userland, die auch die Software Radio Userland produzieren:
http://www.weblogs.com/]
PhiN-Beiheft 2/2004: 62
Anmerkungen
1 Eine erste Schriftfassung dieses Vortrags
wurde am 27.9.2003 unter http://romblog.twoday.net/stories/79057/
online gestellt; Ziel war, eine unmittelbare Diskussionsmöglichkeit des
Beitrags im Internet, d.h. in Weblogs zu schaffen. Für die
endgültige Fassung des Beitrags gilt folgender Umgang mit Links: Für die
Argumentation des Beitrags wesentliche Weblogtexte und -layouts werden im
Wortlaut zitiert bzw. per Screenshot im Text abgebildet, auf andere
Beiträge wird per Link verwiesen. Für die Aktualität dieser externen Links
kann keine Gewähr übernommen werden.
2 Vgl.
allgemein zur Unterschiedung von instrumentellem Mediengebrauch und
medialer Welterzeugung Krämer (2000).
3 Das
Kapitel "Kommentieren" ist zuvor bereits unter dem Titel: "Fill Up Your
Margins! About Commentary and Copia" erschienen in Most (1999: 443–453).
4 Zur
Krise des traditionellen philologischen Kommentars vgl. Reuß (2000); zu Perspektiven, die
Krise evt. durch elektronische Editionen zu überwinden, vgl. Hoffmann /
Jörgensen / Fölsche (1993) und Grésillon (1998). Vgl. zudem den Beitrag von Harald Saller in diesem Band.
5 Eine
grundlegende Klärung des Begriffs findet sich bei Lüdeke [o.J.], dem ich wesentliche
Anregungen für diesen Beitrag verdanke.
6 Vgl.
zu dieser historischen Funktionsbestimmung des Kommentars Lüdeke [o.J.], der sich seinerseits auf Hans-Gert Roloff beruft.
7 Zur
'Geschlossenheit' vs. 'Offenheit' von Kommentaren vgl. Lüdeke [o.J.]
8 Vgl.
den Überblick bei Bohnenkamp (1997), die auch auf die critique génétique eingeht.
9 Vgl.
zum Paradigma der 'Lesbarkeit' von Kultur bilanzierend Neumann / Weigel (2000).
10 Die
inhärenten Probleme das synthetischen Entwurfs Winklers sind für den
Zusammenhang dieser Diskussion nebensächlich: Sie könnten allerdings darin
zu finden sein, dass es zwar nicht falsch, letztlich aber auch nicht
ausreichend ist, Computer allein im Rahmen des Symbolischen zu denken,
weil sich hinter dem Symbolischen immer noch eine grundlegende mediale
Kluft zum digitalen Prozessieren von Daten auftut, die zwar nicht anders
als symbolisch bewältigt werden kann, aber dennoch in einer irreduziblen
Alterität zum Symbolischen steht (vgl. hierzu Tholen 2002: 58). Für die
Analye des Feldes der symbolisch strukturierten Medienpraxis hat diese
irreduzible Differenz jedoch, so weit ich das absehen kann, keine
unmittelbaren Folgen – Winklers Akzentsetzung scheint mir heuristisch
jedenfalls sehr fruchtbar.
11
Vgl. hierzu auch den explizit medientheoretischen Ansatz von Borsò (2001), mit dem sie sich
kritisch gegen Assmann zu profilieren versucht.
12 Es
existieren im Bereich der Romania auch konkurrierende französische bzw.
spanische Neologismen wie "joueb" bzw. "bitácora", die sich aber
offensichtlich gegen den Anglizismus nicht durchsetzen konnten.
13 Der
Begriff steht hier in Anführungszeichen, weil die Frage, ob die so
genannten Werkzeuge generell und auch in diesem speziellen Fall für einen
bereits festgelegten Zweck entwickelt werden oder ob nicht technische
Möglichkeiten auch ihnen korrespondierende Zwecke hervorbringen,
bewusst offen gelassen werden soll. Zu einer kritischen Hinterfragung der
Bedeutung des Werkzeugbegriffs für das Selbstverständnis der Informatik
vgl. Winkler (2003).
PhiN-Beiheft 2/2004: 63
14
Vgl. die Ausführungen des Weblog-Pioniers David Winer (