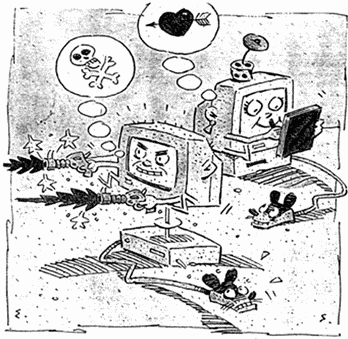ROLAND POSNER
Mensch und Computer als Selbstdarsteller: der Reagan-Effekt *
*Colloquium vom 18. 1. 1996
Für Sabine Kowal und Thomas
Noll
Im Sportteil einer deutschen Tageszeitung lesen wir: "Der Weg ist lang
und steinig. Aber Boxweltmeister Henry Maske scheint schon weit gekommen zu
sein. Der Champion im Halbschwergewicht sagt jetzt über sich selbst:
‘Ich bin jetzt mehr der Henry Maske, der ich wirklich bin.’" (Der
Tagesspiegel, 11. Dezember 1993, S. 12). Worauf er damit hinaus wolle,
erläutert der Zeitungsjournalist: "Das gute Image, das er sich in
seinen knapp vier Profijahren aufgebaut hat, soll nun bare Münze bringen."
Ein Mode-Ratgeber belehrt uns: "Wenn ich nicht mehr weiß, wo ich
stehe und weshalb, muß ich wenigstens gut dastehen" (Sommer und
Wind, 1991, S. 213). Theoretisch gerechtfertigt wird das wie folgt: "Die
Darstellung des Selbst nach außen bedeutet nicht mehr ‘Ich bin der und
der’, sondern ‘Ich könnte der und der sein’. Der Ausdruck wird zum bloßen
Eindruck." (ebd.). Als Beispiel muß die Politik herhalten: "Der
Politiker simuliert einen für inhaltliche Zwecke kämpfenden Menschen,
der ‘Profi’ simuliert den Beruf, den er gerade ausübt." (ebd.).
Ob dies wirklich sein Beruf ist, das ist nicht wichtig: "Was zählt,
ist die professionelle Ausführung, die effektvolle Darstellung."
(ebd.).
Ein Psychoanalytiker schreibt über einen Kollegen: "Mir ist kein
anderer Analytiker begegnet, der ... unvermeidlicher er selbst war als Donald
W. Winnicott. Dieses unverletzliche Er-selbst-sein ermöglichte
es ihm, für die verschiedenartigsten Leute ein je anderer Mensch
zu sein. Wer ihm begegnet ist, hatte seinen je eigenen Winnicott, und dieser
trat dem Bild, das der andere sich von ihm gemacht hatte, niemals dadurch
zu nahe, daß er versuchte, seine eigene Seinsweise durchzusetzen. Und
deshalb blieb er immer so unerbittlich er selbst: Winnicott." (Khan,
1977, S. 348)
Vorausgesetzt, Sie lassen sich auf einen derartigen Diskurs ein, so werden
Sie mit mir fragen: Was bedeutet es, "unvermeidlich man selbst zu sein"
- ist das denn nicht jeder? Doch wie kann das "unverletzliche Er-selbst-sein"
einem dazu verhelfen, von andern jeweils verschieden gesehen zu werden?
Wie schafft es einer, der andern "seine eigene Seinsweise" nicht
aufdrängt, gerade dadurch "unerbittlich er selbst" zu sein?
Diese Fragen stecken das Thema der folgenden Überlegungen ab. Unser
Gegenstand ist das Selbst als Realität, und zwar das Selbst des andern
ebenso wie das eigene Selbst. Wie Sie sehen werden, geht es bei der Schaffung
dieser Realität nicht ohne Selbstdarstellung, Selbstinszenierung, Simulation
und Illusion ab. Deshalb werde ich in einem ersten Teil auf die Arten des
Selbst eingehen, in einem zweiten auf die Weisen des Darstellens und in einem
dritten auf die Typen der Selbstdarstellung. Nach der bewährten Strategie
der Künstliche-Intelligenz-Forschung werde ich dabei über Personen
sprechen: Menschen wie Sie und ich. Die Ergebnisse werde ich aber so verallgemeinern,
daß sie auf alle interaktiven kognitiven Systeme anwendbar sind. Auf
diese Art werde ich Mindestanforderungen formulieren können, die ein
kognitives System erfüllen muß, wenn es in der Lage sein soll,
ein Selbst zu entwickeln.
Der Anschaulichkeit halber empfiehlt es sich, wenn Sie dabei jeweils an einen
bestimmten Menschen und ein bestimmtes kognitives System denken. Bei letzterem
stellen Sie sich einfach Ihren PC vor und fragen Sie sich, wie Sie diesen
aufrüsten müßten, damit Sie ihm jenes unvermeidliche, unverletzliche,
unerbittliche Er-selbst-sein zubilligen können, von dem unser
Psychoanalytiker spricht.
1. Ronald Reagan als Selbstdarsteller
Als exemplarisches menschliches kognitives System habe ich eine Person
ausgewählt, die Sie alle aus den Medien kennen - den größten
Selbstdarsteller der achtziger Jahre; den Theaterschauspieler, Rundfunksprecher,
Football-Reporter, Filmstar, Firmenvertreter, Gewerkschaftsfunktionär;
den Politiker in den Rollen des Gouverneur-Machers, des Gouverneurs von Kalifornien
(1967-1974), des Präsidenten der USA (1980-1988) und des Elder Statesman:
Ronald W. Reagan.

Abb. 1: Ronald und Nancy Reagan 1984.
(Aus: Public Papers of the Presidents of the United States: Ronald
Reagan,
January 1 to June 29, 1984, S. i)
Hat dieser Mensch überhaupt ein Selbst, werden Sie fragen, war er nicht
Spielball wechselnder Kontexte? Hat er je eine eigene Persönlichkeit
gehabt? Falls er wirklich Selbstdarstellung betrieb: Was hat er eigentlich
dargestellt? Seine eigene Persönlichkeit oder diejenige, die ihm seine
jeweiligen Rollen verschafften: die Rollen als Schauspieler, als Rundfunk-Reporter,
als Funktionär, als Politiker?
Reagan ist als öffentliche Person mit seinem Selbst nicht sorglos umgegangen.
Er schrieb (bzw. ließ schreiben) zwei Autobiographien, und er animierte
eine Reihe weiterer Autoren dazu, Fremdbiographien zu verfassen. Seine erste
Autobiographie hatte den Titel Where's the Rest of Me ? (1965),
die zweite An American Life (1990a). Beide Werke versuchten, ein stimmiges
Bild seiner Person aufzubauen, ausgehend von den Erfahrungen seiner Jugend
und seinen Erlebnissen als Schauspieler.
Bezeichnend war, daß Reagan im Titel seiner ersten Autobiographie den
Satz wiederholte, dessen Äußerung ihm die größte Reputation
als Schauspieler eingebracht hatte: "Where's the rest of me?" Es
handelt sich um den Film King's Row von 1941, in dem Reagan einen lebenslustigen
Burschen vom Lande spielte, Drake McHugh. Dieser war in der Wirtschaftsdepression
um sein Geld gekommen, mußte einen Beruf als Eisenbahnarbeiter annehmen,
hatte einen Unfall und geriet in die Hände des Unfallchirurgen Dr. Gordon.
Jener hatte als Vater von einer seiner Freundinnen schon bisher alles unternommen,
um den Wunsch seiner Tochter nach einer Heirat mit Drake zu hintertreiben.
Obwohl Drake inzwischen eine andere geheiratet hatte, war Gordon immer noch
so gegen ihn aufgebracht, daß er ihm nun ohne Not beide Beine bis zum
Oberschenkel amputierte. Beim Aufwachen aus der Narkose tastete Drake nach
seinen Gliedmaßen, rief seine Frau und schrie: "Randy, where's
the rest of me?" Diese Szene gelang dem Drake-Darsteller Reagan damals
so überzeugend, daß sie ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte.

Abb. 2: Nach der Operation ruft Drake seine Frau
und fragt sie verzweifelt: "Randy, where's the rest of me?"
Ronald Reagan als Drake McHugh in dem Film King's Row
(USA 1941, Regie: Samuel Wood, Foto: Stiftung Deutsche Kinemathek, Berlin).
Die Frage "Where is the rest of me?" betraf sowohl das körperliche
wie das geistige Selbst des Fragenden. Sein Körper war verstümmelt
und eine Fortsetzung seines bisherigen Lebens dadurch unmöglich geworden.
Im ersten Absatz seiner Autobiographie von 1965 teilt Reagan mit, daß
seine Mutter beim ersten Blick auf ihr Neugeborenes im Februar 1911 mit erschöpfter
Stimme gesagt hatte: "I think he's perfectly wonderful" (Reagan,
1965 = 1981, S. 3). Und noch auf der gleichen Seite schreibt er weiter unten:
"It was not until thirty years later that I found part of my existence
was missing." Glaubhaft darstellen zu sollen, daß jemand nicht
mehr vollständig war, daß ihm ein Teil seines Selbst abhanden gekommen
war, stellte Reagan "vor die schwerste Herausforderung seines Schauspielerlebens"
(Reagan, 1965 = 1981, S. 4).
Doch was ist dieses Selbst, wenn es einer teilweise verlieren kann, ohne
sich selbst zu verlieren? Diese Frage wird etwas später im gleichen Film
beantwortet. Drakes Frau Randy und sein Freund Parry hatten ihre Entdeckung,
daß er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, sorgfältig vor
ihm verheimlicht. Sie hatten gedacht, es würde ihn ganz umbringen. Eines
Tages aber, als Drake in Schwermut zu fallen drohte, überlegte Parry,
der Psychoanalytiker war, es sich anders. Er glaubte, auf die Dauer könne
nur die Aufdeckung der Wahrheit dem Freund helfen. Wenn sein Selbst vollständig
geblieben war, werde es auch diese schlimme Realität verkraften.

Abb. 3: Drake: "Where did Gordon think
I live, in my legs? Did he think those things were Drake McHugh?" Randy:
"He wanted to destroy the Drake McHugh you were."
Aus dem Film King's Row (USA 1941, Regie: Samuel Wood, Foto: Stiftung Deutsche
Kinemathek, Berlin).
Auf Parrys schreckliche Mitteilung hin vollzieht sich in Drake ein erstaunlicher
Sinneswandel. Zögernd kommt ein Lächeln auf sein Gesicht, und er
sagt verächtlich: "Hat dieser Gordon angenommen, mein Selbst befindet
sich in meinen Beinen? Meint er wirklich, ich bin meine Beine?" - Drakes
Zustand bessert sich in dem Augenblick, in dem er die Gleichsetzung seines
Körpers mit seinem Selbst und eines Körperteils mit einem Teil seines
Selbst ablehnt: "I lost my legs, o.k., but now I found myself again",
sagt er nachdenklich, "I'm still myself as much as ever". Und dann
triumphierend: "The old Drake is there again. Where's the rest of me?
There is no rest of me. I'm as perfect as I ever was."
Die Frage nach der Vollständigkeit seines Selbst sollte Ronald Reagan
nicht nur in seinem virtuellen, sondern bald auch in seinem sozialen und persönlichen
Leben immer wieder beschäftigen. Man wollte ihn, den Schauspieler, als
Politiker nicht für voll nehmen. Reagan erläutert: "Ein so
großer Teil des Schauspielerlebens ist ausgefüllt mit dem Fingieren
anderer, mit dem Proben und Darstellen von Personen, die man selber nicht
ist" (Reagan, 1965 = 1981, S. 6). Das führt dazu, daß die
anderen von einem sagen: "He is only an actor", d. h. "he is
much like I was in King's Row, only half a man" (ebd.). Und er
stimmt dem sogar zu, er selbst fühlte zeitweise: "Ich war ein Halbautomat
geworden, der einen Charakter einer zweiten Person nachschuf, den ein dritter
[der Schriftsteller] erfunden hatte und zu dessen Simulierung ein vierter
[der Regisseur] mich unter seine Fuchtel nahm" (ebd.). Als er in die
Politik ging, mußte Reagan somit eine Strategie finden, um dem Vorwurf
zu begegnen: "Als Schauspieler ... kannst du nichts anderes als schauspielern,
... das ist auch alles, wozu du fähig bist: So tun, als ob" (Reagan,
1990b, S. 148). Er hatte den Verdacht zu entkräften: "Der lernt
nur Reden auswendig, die von anderen geschrieben sind, genau wie er als Schauspieler
die Dialoge anderer auswendig gelernt hat" (Reagan, 1990b, S. 148f.).
Reagan gelang es, einen Ausweg aus dieser Zwickmühle zu finden, und
der war so simpel wie wirkungsvoll: Er versuchte sich selbst zu präsentieren,
wie er war. Er beschränkte am Anfang seiner politischen Karriere seine
Auftritte auf ein paar einleitende Worte, um dann die direkte Diskussion der
politischen Fragen mit dem Publikum zu suchen (Reagan, 1990b, S. 149).
Um zu zeigen, wer er war, hatte er reaktionsschnell und schlagfertig zu sein.
Er schaffte dies, indem er sich einen Fundus von Witzen aneignete, die flexibel
anwendbar waren, und Geschichten aus seinem eigenen Leben zum besten gab.
Der Inhalt seiner Botschaften war nicht so wichtig, er brauchte auch nicht
besonders differenziert vorgetragen zu werden. Wichtig war, daß der
Darsteller dieses Inhalts sich selbst in den wechselnden Kontexten treu zu
bleiben schien, d. h. daß der Inhalt seiner Botschaften sich nicht veränderte.
Ausschlaggebend für Erfolg oder Mißerfolg war auch in der Politik
nie sein eigener Eindruck von seinem Auftritt, sondern der des Publikums.
Und dieser bestimmte wiederum, welche Seiten seines Verhaltens Reagan ausbaute.
Das Publikum entschied über Reagans Selbst. Diese Lebenserfahrung durchzieht
die Autobiographie wie ein roter Faden.
Reagan dokumentiert dankbar anhand von Jugenderlebnissen, wie andere ihn
zu dem gemacht haben, der er war. "Meine Mutter", schreibt er, "war
der unerschütterlichen Überzeugung, daß alle sie lieb haben
mußten, nur weil sie alle lieb hatte" (Reagan, 1965 = 1981, S.
9). Diese Einstellung färbte auf den Jungen ab.

Abb. 4: Reagan, der Schauspieler, mit seinen Eltern
(aus: Reagan, 1990b, Abb.4).
Auch den Anstoß und den Durchbruch zur Schauspielerei hatte Reagan
andern zu verdanken. Als seine Eltern mit dem neunjährigen Ronnie und
seinem älteren Bruder in das Landstädtchen Dixon zogen, organisierte
seine Mutter einen Club zur Rezitation von Theaterstücken und anderer
Literatur, in dem ihre Freunde und Bekannten als Rezitatoren auftraten. Reagan
erinnert sich: "Eines Tages half sie mir, eine kurze Rede auswendig zu
lernen, und wollte mich überreden, sie am Abend bei einem ‘Vortrag’ darzubieten,
aber ich weigerte mich. Mein Bruder war schon mehrfach aufgetreten, und das
mit großem Erfolg; er konnte wirklich singen und tanzen wie kaum ein
anderer, und viele in Dixon meinten, er würde sogar einmal im Showbusiness
landen. Aber ich war schüchterner als er und sagte meiner Mutter, ich
wollte nicht. Dennoch schien in mir ... ein wenig Ehrgeiz zu stecken, jedenfalls
genug, daß ich meinem Bruder nicht nachstehen wollte, und so ließ
ich mich schließlich überreden. Ich nahm all meinen Mut zusammen
und trat an jenem Abend schließlich auf die Bühne, räusperte
mich und gab mein Theaterdebüt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagte,
aber nie werde ich die Reaktion vergessen: Die Leute lachten und applaudierten.
Das war eine neue Erfahrung für mich, und sie gefiel mir. Ich mochte
den Beifall. Für einen Jungen, der unter Minderwertigkeitskomplexen litt,
war der Applaus Musik. Ich wußte es damals nicht, aber als ich an jenem
Abend die Bühne verließ, hatte sich mein Leben in gewisser Weise
verändert." (Reagan, 1990b, S. 31)
Reagan beschreibt mehrere solche Angelpunkte seines Lebens, und alle zeigen,
welchen Einfluß die Meinung anderer darauf hatte, was er von sich selbst
hielt. Am College war er Mitglied eines Schülertheaters, und er schildert
die Begeisterung, mit der seine Theatertruppe reagierte, als sie bei einem
Wettbewerb an einer anderen Universität den zweiten Platz belegte: "Während
wir uns im Erfolg sonnten, wurde [...] bekanntgegeben, daß ich einer
der drei Darsteller sei, denen noch zusätzlich Preise für die beste
schauspielerische Leistung verliehen werden sollten. Danach rief mich der
Leiter [...] des Festivals in sein Büro und fragte mich, ob ich schon
einmal an eine Laufbahn als Schauspieler gedacht hätte. Ich sagte: ‘Well
no’, und er darauf: ‘Well, das sollten Sie aber.’" (Reagan, 1990b, S.
55). Reagan kommentiert: "Wahrscheinlich war das der Tag, an dem mich
der Virus der Schauspielerei endgültig packte, wenn ich auch glaube,
daß er schon ziemlich lange in mir sein Unwesen getrieben hatte."
(ebd.).
Diese Abhängigkeit von den Meinungen anderer hatte allerdings auch ihre
Nachteile. Als Rundfunksprecher zum Beispiel stolperte Reagan mehrfach darüber:
"Das Geheimnis der Rundfunkansage", schreibt er, "liegt darin,
das Lesen so klingen zu lassen, als handelte es sich um unvermitteltes Sprechen.
Mir macht es aber bis heute Schwierigkeiten, ein Manuskript auf Anhieb zu
lesen. Zu jener Zeit war ich darin ganz schlecht. Ich wußte das, und
die Zuhörer wußten es auch. Schlimmer noch: auch die Sponsoren
wußten es. So gelang es mir nicht, dem Gesprochenen jenen Gesprächston
zu geben, der überzeugend gewesen wäre." (Reagan, 1965 = 1981,
S. 56).
Die ständige Brechung der Selbstwahrnehmung durch die Wahrnehmung der
anderen wird mein Thema bleiben. Es läßt sich zuspitzen auf die
Frage: Inwiefern ist, was einer ist, das, was die anderen von ihm halten?
2. Arten des Selbst
Versuchen wir die Fragen nach dem Selbst und der Selbstdarstellung nun durch
Einbettung in die semiotische Theorienbildung zu beantworten. Sie erhalten
dann die Form: Wieviel am Selbst beruht auf Selbstdarstellung? Welche Art
von Zeichenprozeß ist die Selbstdarstellung?
Um diese Frage zu beantworten, empfiehlt es sich, zunächst eine Reihe
von Selbst-Begriffen zu prüfen. Ich werde sie durch Beispiele aus dem
Leben des jungen Reagan exemplifizieren (und mir dabei erlauben, seine Biographie
ein wenig zu ergänzen).
2.1. Die Persönlichkeit (das Selbst im engeren Sinn)
Denken wir an die Reagan-Familie: Der ständig auf Jobsuche befindliche
Vater mußte wieder einmal umziehen. Der kleine Ronnie kam in die zweite
Schulklasse eines fremden Ortes, der Lehrer kannte ihn nicht. Er wollte wissen,
wie Ronnie seinen Namen schreiben konnte. Dieser malte nun in Schönschrift
"Ronald" an die Tafel. Der Lehrer sah das Ergebnis und sagte vor
der ganzen Klasse mit leichter Überraschung: "Du bist ja ein Schönschreiber."
Der Lehrer a wird hier durch eine einzige Handlung f (das Schönschreiben)
des Schülers b dazu veranlaßt, b ein permanentes
Merkmal F (Schönschreiber) zu attribuieren:
(1a)
T(b,f)
[b vollzieht Schönschreiben]
(1b)
F (b)
[b ist ein Schönschreiber]
Ein Schönschreiber zu sein, wird so zum Persönlichkeitsmerkmal
erhoben und Ronnies Selbst wird vom Lehrer als Menge { } solcher Persönlichkeitsmerkmale
P konstruiert. Entsprechend wollen wir unter der "Persönlichkeit"
eines Menschen b die Menge der permanenten Merkmale von b verstehen:
(S1)
{ P | P(b) }
[die Menge aller P, für die P(b) gilt]
Als Persönlichkeit in diesem Sinne wurde das Selbst bereits in der Psychologie
der Aufklärungszeit betrachtet. Autoren wie Friedrich Schiller diente
diese Auffassung als theoretische Grundlage für ihr Theaterschaffen.
Schiller hat bekanntlich die Kriminalistik seiner Zeit studiert und seine
eigenen Stücke nach dem Prinzip geschrieben, der Zuschauer solle aus
den Taten des Delinquenten auf dessen Charakter schließen. Im fünften
Brief Über die ästhetische Erziehung des Menschen stellt
Schiller fest: "In seinen Taten malt sich der Mensch." (Schiller,
1795 = 1962, S. 580) Wir alle versuchen, aufgrund des Verhaltens in Einzelsituationen
einander lang anhaltende Charaktereigenschaften als Persönlichkeitsmerkmale
zuzuordnen, um angemessen miteinander umgehen zu können.
2.1. Das Selbstkonzept (das Eigenkonzept-Selbst)
Für den kleinen Ronnie war der Lehrer eine große Autorität.
Durch sein Lob fühlte er sich bestätigt und hielt sich nun selbst
für einen Schönschreiber. Jedesmal, wenn er etwas an die Tafel schrieb,
schrieb er es so schön, wie er nur konnte:
(2a)
T(b,f)
[b tut f]
weil er glaubte, daß er ein Schönschreiber war:
(2b)
G(b, F(b))
[b glaubt, daß b ein F ist]
Das Schönschreibenkönnen (Schönschreibersein) gehörte
nun zu dem Eigenkonzept, das b von sich hatte: zu dem, was b
von sich selbst glaubte.
Dementsprechend bezeichnen wir als "Eigenkonzept-Selbst" einer
Person b die Menge aller permanenten Merkmale P, von denen b
glaubt, daß sie seine Persönlichkeitsmerkmale sind:
(S2)
{ P | G (b, P(b)) }
[die Menge aller P, von denen b glaubt, daß P(b)
gilt]
Das "Eigenkonzept-Selbst" wird in der Attributionspsychologie als
"Selbstkonzept" bezeichnet und bei der Untersuchung des Selbst zugrunde
gelegt (vgl. Gergen, 1971; Epstein, 1979; Mummendey, 1991).
2.3. Das Image (das Fremdkonzept-Selbst)
Die Fähigkeit, die der Lehrer bei Ronnie entdeckt hatte, brachte diesem
eine Reihe von Vorteilen: Der Lehrer griff gern auf ihn zurück, und die
Mitschüler ließen ihm den Vortritt, wenn es darum ging, Sätze
an die Tafel zu schreiben, denn sie glaubten, daß er dies am besten
konnte. Sie hielten ihn für einen Schönschreiber:
(3)
G(a, F(b))
[a glaubt, daß b ein F ist]
Die Mitschüler hatten ein bestimmtes Bild von Ronnie. Das Schönschreibersein
gehörte zu seinem Image bei ihnen.
Im Gegensatz zum Eigenkonzept-Selbst bezeichnen wir dieses Image als "Fremdkonzept-Selbst"
von b und definieren es als die Menge der permanenten Merkmale P,
von denen die andern a glauben, daß sie b's Persönlichkeitsmerkmale
sind:
(S3)
{ P | G(a, P(b)) }
[die Menge aller P, von denen a glaubt, daß P(b)
gilt]
Das Fremdkonzept-Selbst einer Person nannte William James 1890 "social
self", und als solches analysierte es George Herbert Mead in umfangreichen
Abhandlungen (1934 und 1964).
2.4. Der Selbstwunsch (das Eigenwunsch-Selbst)
Trotz aller Vorteile empfand Ronnie mit der Zeit seine Rolle als Schönschreiber
und Liebling des Lehrers als allzu einseitig. Er wollte sich auch außerhalb
des Klassenzimmers bewähren und versuchte deshalb, ein guter Schwimmer
zu werden:
(4)
I(b, F(b))
[b will, daß b ein F ist]
Das fiel ihm auch nicht schwer. Er sprang oft in den Fluß und schwamm
gegen den Strom. Er schwamm unter Wasser und freute sich, über wie lange
Strecken er den Atem anhalten konnte.
Der Wunsch, ein guter Schwimmer zu sein, gehört zu dem, was wir "Eigenwunsch-Selbst"
nennen. Im Gegensatz zum "Eigenkonzept-Selbst" definieren wir das
"Eigenwunsch-Selbst" einer Person b als die Menge der permanenten
Merkmale P, die b als Persönlichkeitsmerkmale haben will:
(S4)
{ P | I (b, P(b)) }
[die Menge aller P, von denen b will, daß P(b)
gilt]
Viele der Merkmale, die im Eigenwunsch-Selbst S4 einer Person zusammengefaßt
sind, lassen sich durch "Arbeit an sich selbst" zu Bestandteilen
der eigenen Persönlichkeit (des Selbst im engeren Sinn S1) machen.
2.5. Der Fremdwunsch (das Fremdwunsch-Selbst)
Auch die Mitschüler hatten bestimmte Wünsche an Ronnie. Sie wollten,
daß er außerhalb der Schule mit ihnen spielte, ohne böse
zu werden, wenn er verlor. Sie wünschten sich, daß ihr Schulkamerad
ein fairer Mitspieler war.
(5)
I(a, F(b))
[a will, daß b ein F ist]
Dies fiel Ronnie noch schwer, und so hatte er es nicht leicht in der Klasse.
Der Wunsch der andern, daß eine Person ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal
hat, gehört zu dem, was wir das "Fremdwunsch-Selbst" dieser
Person nennen. Im Gegensatz zum Eigenwunsch-Selbst definieren wir es als Menge
der permanenten Merkmale P, von denen die andern a wollen, daß
eine Person b sie als Persönlichkeitsmerkmale hat:
(S5)
{ P | I (a, P(b)) }
[die Menge aller P, von denen a will, daß P(b)
gilt]
2.6. Das Imagekonzept (Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst)
Wenn wir das, was Ronnie war (sein Selbst im engeren Sinn S1) mit dem vergleichen,
was er zu sein glaubte (sein Eigenkonzept-Selbst S2) und was er sein wollte
(sein Eigenwunsch-Selbst S4), sowie mit dem, was die andern von Ronnie glaubten
(sein Fremdkonzept-Selbst S3) und von ihm wünschten (sein Fremdwunsch-Selbst
S5), so gibt es vielerlei Möglichkeiten der Übereinstimmung und
Differenz. Stimmt das, was einer ist, mit dem überein, was die andern
von ihm glauben und wollen, so gibt es keine Schwierigkeiten. Dies ist aber
selten für alle Persönlichkeitsmerkmale der Fall. Auch Ronnie mußte
diese Erfahrung machen. Er hielt sich für einen guten Football-Spieler:
(6a)
G(b, F(b))
[b glaubt, daß b ein F ist]
Die Mitschüler aber zogen andere ihm gegenüber vor, wenn es um
die Aufstellung der Klassenmannschaft ging:
(6b)
G(a,¬F(b))
[a glaubt, daß b kein F ist]
So kam Ronnie dazu einzusehen, daß sein Image als Football-Spieler
bei den Mitschülern seiner Selbsteinschätzung nicht entsprach:
(6c)
G (b, G(a, ¬F(b)))
[b glaubt, daß a glaubt, daß b kein F
ist]
In solchen Situationen bildete Ronnie sich ein Eigenkonzept über das
Fremdkonzept von seinem Selbst, d. h. er konstruierte sein Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst.
Mit anderen Worten, er machte sich Gedanken um sein Image bei den Mitschülern
und entwickelte ein bestimmtes Imagekonzept. "Es hat Jahre gedauert,
bis ich mich so sehen lernte, wie die anderen mich sahen", schreibt Reagan
später in seiner Autobiographie (1965 = 1981, S. 79).
Das "Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst" einer Person b definieren
wir als die Menge der permanenten Merkmale P, von denen b glaubt,
daß die andern a glauben, daß sie b's Persönlichkeitsmerkmale
sind (d.h. von denen b glaubt, daß sie seinem Fremdkonzept-Selbst
angehören):
(S6)
{ P | G(b, G(a, P(b))) }
[die Menge aller P der Art, daß b glaubt, daß
a glaubt, daß P(b) gilt]
Das Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst ist das, was der Psychiater Ronald Laing
(1960) als "Metabild" einer Person bezeichnet. Das Metabild (Imagekonzept)
einer Person kann sowohl von deren Image als auch von deren Selbstbild (Selbstkonzept)
als auch von deren Persönlichkeitsmerkmalen (Selbst im engeren Sinn)
abweichen. Ronnie war de facto ein mittelmäßiger Football-Spieler,
betrachtete sich aber zeitweilig als Genie und dachte öfters, daß
die andern ihn für einen Versager hielten, während er ihnen doch
nur mittelmäßig schien.
2.7. Der Imagewunsch (das Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst)
Was konnte ein Schuljunge wie Ronnie tun, wenn er sein Image als Football-Spieler
aufpolieren wollte? Er übte fleißig für sich und nahm jede
Gelegenheit wahr, die sich ihm bot, um vor den Augen der andern gut Football
zu spielen:
(7a)
T(b, f)
[b vollzieht gutes Football-Spielen]
Das tat er mit der Absicht, Tatsachen zu schaffen, die bewirkten, daß
die andern glaubten, er sei ein guter Football-Spieler:
(7b)
I(b, E(f) -> G(a, F(b)))
[b will, daß gutes Football-Spielen bewirkt, daß a
glaubt, daß b ein guter Football-Spieler ist]
Wer sich so verhält, versucht sich einen Imagewunsch zu erfüllen.
Technisch gesprochen, geht es um einen Eigenwunsch für ein Fremdkonzept
von seinem Selbst, d.h. um ein Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst.
Das "Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst" einer Person definieren wir
als die Menge der permanenten Merkmale P, von denen b will,
daß die andern a glauben, daß sie b's Persönlichkeitsmerkmale
sind (d.h. von denen b will, daß sie seinem Fremdkonzept-Selbst
angehören):
(S7)
{ P | I(b, G(a, P(b))) }
[die Menge aller P der Art, daß b will, daß a
glaubt, daß P(b) gilt]
Allerdings birgt Imagepflege dieser Art die Gefahr, daß die angestrebte
Wirkung in ihr Gegenteil umschlägt: Die andern halten einen dann nicht
für einen guten Football-Spieler, sondern für einen Angeber.

Abb. 5: Reagan als Modell eines Football-Spielers
vor einer Bildhauerklasse der Universität von Südkalifornien
(Foto: Friedman, 1986, S. 37).
Der Filmkonzern Warner Brothers vermarktet Reagan in dieser Weise als
"Adonis des 20. Jahrhunderts mit der der Vollkommenheit am nächsten
kommenden männlichen Gestalt in Hollywood".
2.8. Das Imagewunsch-Konzept (das Fremdkonzept-Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst)
In der Tat hat der historische Ronnie seine Imagekorrektur erheblich übertrieben.
Er wollte nicht nur ein vorbildlicher Schwimmer, sondern auch ein guter Football-Spieler
sein, und daß er dies bei allen Gelegenheiten zeigte, ging seinen Mitschülern
auf die Nerven. Sie bildeten sich ein Konzept von seiner Geltungssucht, d.
h. ein Fremdkonzept seines Imagewunsches entstand. Sein aufdringlich gutes
Football-Spielen bewirkte nicht nur, wie beabsichtigt (vgl. die Formel (7b)),
daß die Mitschüler glaubten, daß er ein guter Football-Spieler
war:
(8a)
E(f) -> G (a, F(b))
[Gutes Football-Spielen bewirkt, daß a glaubt, daß
b ein guter Football-Spieler ist]
sondern auch, daß sie glaubten, daß er wollte, daß sie
das glaubten:
(8b)
E(f) -> G (a, I(b, G(a, F(b))))
[Gutes Football-Spielen bewirkt, daß a glaubt, daß
b will, daß a glaubt, daß b ein guter Football-Spieler
ist]
Ronnie wurde so zum Angeber. Seine tatsächlichen positiven Persönlichkeitsmerkmale
verblaßten hinter der Unterstellung, daß er sie nur dazu entwickelt
hatte, um sie den andern vorführen zu können. Eine solche Unterstellung
ist ein Beispiel für ein Imagewunsch-Konzept. Technisch gesprochen, handelt
es sich um ein Fremdkonzept-Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst:
(S8)
{ P | G (a, I(b, G(a, P(b)))) }
[die Menge aller P, von denen a glaubt, daß b
will, daß a glaubt, daß P(b) gilt]
Als Angeber zu gelten, ist kein gutes Image, und Ronnie wußte dem zu
begegnen. Doch möchte ich es Ihnen überlassen, sich die dafür
geeigneten Verhaltensweisen auszumalen, und die Serie der Selbst-Begriffe
an dieser Stelle abbrechen, um Bilanz zu ziehen.
Vergleichen wir die Definitionen der bisher eingeführten Selbst-Begriffe:
S1: Selbst im engeren Sinn
S2: Eigenkonzept-Selbst
S3: Fremdkonzept-Selbst
S4: Eigenwunsch-Selbst
S5: Fremdwunsch-Selbst
S6: Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst
S7: Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst
S8: Fremdkonzept-Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst,
so können wir feststellen, daß jedes Selbst eine Menge von Merkmalen
P enthält, die einer Person b entweder direkt oder durch
Glauben und Intendieren vermittelt zugeschrieben werden. In den Formeln (S1)
bis (S8) wurde für "Glauben" G(..., ...) und für
"Intendieren" I(..., ...) gesetzt, in den Beispielen wurden
statt "Glauben" auch manchmal die Verben annehmen, vermuten,
halten für und statt "Intendieren" die Verben wollen,
wünschen, beabsichtigen verwendet. Die Tiefe der Einbettung
der Merkmalszuschreibung in das Glauben und in das Intendieren läßt
sich beliebig steigern. Sie ist, wie die Beispiele zeigen, von der Komplexität
der Situationen abhängig, die der betreffende Mensch mit seinen Mitmenschen
bewältigen muß. (Eine systematische Auflistung aller beteiligten
Selbst-Begriffe findet sich in Posner, 1996.)
Abb. 6: Das stratifizierte Gesamt-Selbst
mit seinen Teil-Selbsten auf den Reflexionsstufen RS0, RS1, RS2 usw.
Daraus ergibt sich, daß eine offene Menge von beliebig komplexen Selbsten
konstruierbar ist. Jeder Mensch hat an mehreren von ihnen teil. Die Menge
der Selbste, die eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelt hat,
nenne ich deren "Gesamt-Selbst". Das maximale Gesamt-Selbst der
Person b läßt sich kennzeichnen durch die Formel:
(GS)
{ P | ... P(b) }
[die Menge der P, für die gilt, daß ... P(b)]
Die Pünktchen in dieser Formel können durch beliebig viele komplexe
Folgen der Prädikatoren G(..., bzw. I(..., ersetzt werden,
so daß aus GS die Menge der Teil-Selbste von b S1, S2, ... S8,
... entsteht.
Jedes Gesamt-Selbst läßt sich auf naheliegende Weise gliedern,
wenn wir die Struktur der Einbettungen der Merkmalszuschreibungen in das Glauben
und Intendieren zum Kriterium nehmen, um die Teil-Selbste verschiedenen Reflexionsstufen
zuzuordnen.
Ein Sachverhalt gehört zur Reflexionsstufe RS0, wenn er kein Glauben
oder Intendieren enthält. Das Selbst im engeren Sinn S1 ist eine Menge
von Merkmalszuschreibungen dieser Art: { P | P(b) }. S1 befindet sich
daher auf der Reflexionsstufe RS0.
Ein Sachverhalt gehört zur Reflexionsstufe RS1, wenn er im Glauben oder
Intendieren eines Sachverhalts der Reflexionsstufe RS0 besteht. Das Eigenkonzept-Selbst
S2 ist eine Menge von Merkmalszuschreibungen nullter Stufe, die von der betreffenden
Person geglaubt werden: { P | G(b, P(b)) }; das Fremdkonzept-Selbst
S3 ist eine Menge von Merkmalszuschreibungen nullter Stufe, die von anderen
geglaubt werden: { P | G(a, P(b)) }; das Eigenwunsch-Selbst S4 ist
eine Menge von Merkmalszuschreibungen nullter Stufe, die von der betreffenden
Person gewünscht werden: { P | I(b, P(b)) }; das Fremdwunsch-Selbst
S5 ist eine Menge von Merkmalszuschreibungen nullter Stufe, die von den anderen
gewünscht werden: { P | I(a, P(b)) }. Alle diese Selbste S2 bis
S5 befinden sich also auf der Reflexionsstufe RS1.
Ein Sachverhalt gehört zur Reflexionsstufe RS2, wenn er im Glauben oder
Intendieren eines Sachverhalts der Reflexionsstufe RS1 besteht. Das Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst
S6 ist eine Menge von Merkmalszuschreibungen erster Stufe, die von der betreffenden
Person geglaubt werden: { P | G(b, G(a, P(b))) }; das Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst
S7 ist eine Menge von Merkmalszuschreibungen erster Stufe, die von der betreffenden
Person gewünscht werden: { P | I(b, G(a, P(b))) }. Die Selbste
S6 und S7 befinden sich daher auf der Reflexionsstufe RS2. Die weiteren Selbste
der Reflexionsstufe RS2 sind in Abbildung 6 zusammengestellt.
Das Fremdkonzept-Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst S8 ist eine Menge von Merkmalszuschreibungen
der Reflexionsstufe RS2, die von anderen geglaubt werden: { P | G(a, I(b,
G(a, P(b)))) }. Es befindet sich daher auf der Reflexionsstufe RS3.
Ein Gesamt-Selbst, das in dieser Weise in Reflexionsebenen gegliedert ist,
nennen wir "stratifiziertes Gesamt-Selbst". Wie die besprochenen
Beispiele aus dem Leben des jungen Reagan zeigen, geht es bei der Selbstdarstellung
einer Person in jedem Einzelfall weniger um deren Gesamt-Selbst als um ein
bestimmtes Teil-Selbst.
Die eingeführten Selbst-Begriffe kennzeichnen, was dargestellt wird,
wenn eine Person sich darzustellen versucht. Damit ist unsere erste Frage
beantwortet, und wir können uns nun den Weisen des Darstellens zuwenden,
um schließlich zu bestimmen, was man unter Selbstdarstellung versteht.
3. Weisen des Darstellens
Zur Beantwortung der Frage nach den Arten des Selbst habe ich Konfigurationen
der Begriffe "Merkmal", "Glauben" und "Intendieren"
benutzt. Auf derselben Grundlage läßt sich auch die Frage nach
dem Vorgang beantworten, den man "Darstellen" nennt. Jede Darstellung
ist ein Zeichenprozeß, und wer Zeichen produziert, tut etwas mit der
Absicht, daß es bewirkt, daß andere etwas glauben.
Selbstdarstellung ist dann gegeben, wenn das, was die andern glauben sollen,
ein Persönlichkeitsmerkmal dessen betrifft, der sie dieses glauben machen
will.
Durch Verwendung der Begriffe "Glauben" und "Intendieren",
ergänzt durch den Begriff der Kausalität ("Bewirken"),
erhalten wir also nicht nur Aufschluß über die Arten des Selbst,
sondern auch über die Struktur der beteiligten Zeichenprozesse. Auf dieser
Grundlage ist es sogar möglich, alle überhaupt denkbaren Typen von
Zeichenprozessen systematisch zu ordnen (vgl. Posner, 1993 und 1995).
Im jetzigen Zusammenhang besteht unsere Aufgabe nur darin, die Ordnung der
Zeichenprozesse zu skizzieren, soweit sie die verschiedenen Weisen des Darstellens
erschließt. Begeben wir uns zu diesem Zweck wieder in das Landstädtchen
Dixon, in dem Ronald Reagan einen Teil seiner Jugend verbrachte, und versuchen
wir es durch seine Augen zu betrachten.

Abb. 7: Das Haus der Reagan-Familie in
Dixon
3.1. Das Anzeichen
In Dixon gab es eine Gegend mit Wochenendhäusern, die einen großen
Teil der Woche unbewohnt waren. Ronnie trieb sich gerne dort herum. Als er
eines der Häuser anschaute, merkte er, daß ein Fenster offenstand.
Das brachte ihn dazu zu glauben, daß das Haus bewohnt war:
(D1)
E (f) -> G (a, p)
[Das Auftreten von f bewirkt, daß a glaubt, daß
p]
Dadurch daß das Offenstehen des Fensters ihn auf die Bewohntheit des
Hauses hinwies, wurde es für Ronnie zum Anzeichen. Wir haben also einen
Anzeichenprozeß vor uns. Anzeichen sind Sachverhalte, die bewirken,
daß jemand etwas Bestimmtes glaubt. Die betreffende Person nennen wir
Rezipient, und das Geglaubte ist die "Botschaft". Anzeichen
erfordern weder, daß das Geglaubte wahr ist, noch, daß es jemand
gibt (einen Sender), der diesen Glauben herbeiführen will.
3.2. Die Anzeichen-Produktion
Als Ronnie wieder einmal in der Gegend war, öffnete sich in einem der
besagten Häuser gerade eine Dachluke. Ronnie bemerkte das Aufgehen des
Fensters, und das brachte ihn dazu zu glauben, daß das Haus bewohnt
war. Hier gab es eine Person b, die einen Sachverhalt herstellte, welcher
bei einer anderen Person einen bestimmten Glauben bewirkte:
(D2)
T (b, f) Ù
E (f) -> G (a, p)
[b tut f, und das Auftreten von f bewirkt, daß
a glaubt, daß p]
Das Aufgehen des Fensters ist ein Anzeichen im Sinne von (D1). Die Herstellung
eines solchen Anzeichens bezeichnen wir als "Anzeichen-Produktion".
Dabei brauchte die Person, die das Fenster öffnete, nicht zu wissen,
daß jemand dies beobachtete, und auch nicht zu beabsichtigen, daß
der Beobachter daraus seine Schlüsse zog. Anzeichen-Produktion kann auch
unabsichtlich erfolgen.
3.3. Die Anzeige-Handlung
Ronnie hatte es gern, wenn Klassenkameraden auf einen Sprung bei ihm vorbeischauten,
um mit ihm zu spielen. Damit seine Kameraden wußten, woran sie waren,
noch bevor sie das Grundstück betraten, öffnete er stets das Fenster,
wenn er sich in seinem Zimmer aufhielt. Mit dem Öffnen des Fensters beabsichtigte
er zu bewirken, daß seine Kameraden glaubten, daß er in seinem
Zimmer war:
(D3)
T (b,f) Ù
I (b, E(f) -> G(a, p))
[b tut f, und b beabsichtigt, daß das Auftreten
von f bewirkt, daß a glaubt, daß p]
Das Fensteröffnen ist hier nicht nur unabsichtliche Anzeichen-Produktion,
sondern es erfolgt mit der Absicht, daß ein Rezipient eine ganz bestimmte
Botschaft daraus erschließt. Einen solchen Zeichenprozeß nennen
wir "Anzeige-Handlung". Die Botschaft einer Anzeige-Handlung muß
nicht wahr sein: Einerseits gab es Situationen, in denen Ronnie vergaß,
das Zimmerfenster zu öffnen; andererseits wurde das Fenster auch in seiner
Abwesenheit gelegentlich von seiner Mutter geöffnet.
3.4. Der Ausdruck
Nimmt ein Rezipient einen Sachverhalt als Anzeichen dafür, daß
sein Produzent sich in einem bestimmten Zustand befindet, so bezeichnen
wir den Sachverhalt als "Ausdruck" dieses Zustands. So hatte
die Mutter Ronnie ein Blumenbeet im Garten zur Bearbeitung zugeteilt. Die
Tatsache, daß die Blumen auf diesem Beet immer gut gegossen waren, nahm
sie als Ausdruck von Ronnies Gewissenhaftigkeit:
(D4)
E(f) -> G(a, Z(b))
[Das Auftreten von f bewirkt, daß a glaubt, daß
b im Zustand Z ist]
Daß jemand einen Sachverhalt als Ausdruck eines Zustands seines Produzenten
ansieht, muß nicht heißen, daß es tatsächlich
einen solchen Produzenten gibt und daß dieser sich in diesem
Zustand befindet. Ronnies Tante konnte das Beet gegossen haben,
um Ronnie die Arbeit abzunehmen.
3.5. Die Ausdrucks-Produktion
Hat Ronnie das Beet tatsächlich regelmäßig gegossen, so muß
er es nicht mit der Absicht getan haben, daß seine Mutter ihn für
gewissenhaft hielt. Man kann sich gewissenhaft verhalten, ohne selbst daran
zu denken und ohne es andern zeigen zu wollen. In einem solchen Fall produziert
ein Mensch zwar einen Sachverhalt, den andere zu Recht als Ausdruck seines
Zustandes nehmen, er tut dies aber unabsichtlich:
(D5)
T (b, f) Ù
E (f) -> G(a, Z(b))
[b tut f, und das Auftreten von f bewirkt, daß
a glaubt, daß b im Zustand Z ist]
Die Herstellung eines Ausdrucks in diesem Sinne bezeichnen wir als "Ausdrucks-Produktion".
3.6. Die Ausdrucks-Handlung
Ronnie war es durchaus angenehm, als gewissenhaft zu gelten, denn dies brachte
ihm Lob und Anerkennung ein. Daher goß er die Blumen tatsächlich
mit der Absicht, daß dies bei seiner Mutter bewirkte, daß sie
glaubte, er war gewissenhaft:
(D6)
T (b, f) Ù
I (b, E(f) -> G(a, Z(b)))
[b tut f, und b beabsichtigt, daß das Auftreten
von f bewirkt, daß a glaubt, daß b im Zustand
Z ist]
Die Produktion eines Sachverhalts mit der Absicht, daß sie einen Rezipienten
dazu bringt, einen bestimmten Zustand des Produzenten anzunehmen, nennen wir
"Ausdrucks-Handlung", denn durch diese Handlung drückt
der Betreffende seinen Zustand aus.
Vergleichen wir diese sechs Arten von Zeichenprozessen D1 bis D6 miteinander,
so können wir feststellen, daß es sich um sechs verschiedene Weisen
des Darstellens handelt: Im elementaren Anzeichen-Prozeß D1 braucht
es niemanden zu geben, der etwas darstellt; daher sagen wir allenfalls:
"Das Haus stellt sich dem Rezipienten als bewohnt dar."
Bei der Anzeichen-Produktion D2 gibt es zwar jemanden, der durch sein Tun
einen Sachverhalt darstellt: Ein Bewohner stellt dem Rezipienten das Haus
als bewohnt dar. Aber dies kann unabsichtlich geschehen.
Erst bei der Anzeige-Handlung D3 kommt es zur Darstellung im engeren Sinn.
Ronnie stellt seinen Kameraden mit voller Absicht sein Zimmer als besetzt
dar.
Auf alle drei Fälle läßt sich somit das Verb "darstellen"
anwenden. Aber von "Darstellung im engeren Sinn" sprechen wir nur
in Fällen vom Typ D3, d. h. wenn es jemanden gibt, der einen Sachverhalt
herstellt und damit beabsichtigt, daß andere ihn als Anzeichen für
das Bestehen eines weiteren Sachverhalts nehmen.
Die Zeichenprozesse des Typs D4 bis D6 sind besondere Fälle des Darstellens,
insofern ihre Botschaft einen Zustand eines (angenommenen oder tatsächlichen)
Anzeichen-Produzenten betrifft. In solchen Fällen sprechen wir von Ausdruck.
Beim elementaren Ausdrucks-Prozeß D4 braucht es wiederum niemanden zu
geben, der etwas ausdrückt; wir können sagen: "Im Blumenbeet
drückt sich Gewissenhaftigkeit aus", ohne zu wissen, ob es einen
ständigen Betreuer hat und ob dieser derartiges ausdrücken wollte.
Bei der Ausdrucks-Produktion D5 gibt es zwar jemanden, der durch sein Tun
einen eigenen Zustand ausdrückt: Ronnie drückt durch das regelmäßige
Gießen des Blumenbeets seine Gewissenhaftigkeit aus. Aber das kann unabsichtlich
geschehen.
Erst bei der Ausdrucks-Handlung D6 haben wir einen Ausdruck im engeren Sinn
vor uns: Ronnie gießt regelmäßig die Blumen als Ausdruck
seiner Gewissenhaftigkeit. Von "Ausdruck im engeren Sinn" sprechen
wir, wenn es jemanden gibt, der etwas tut und damit beabsichtigt, daß
andere es als Anzeichen für einen Zustand nehmen, in dem er sich befindet.
4. Typen der Selbstdarstellung
Fragen wir uns nun, welche der besprochenen Weisen des Darstellens als Selbstdarstellung
anzusehen sind, so liegt es nahe, von der Ausdrucks-Produktion D5 und der
Ausdrucks-Handlung D6 auszugehen. In beiden Fällen geht es um Darstellung,
und in beiden Fällen ist das Dargestellte ein Zustand des Darstellers.
Wenn wir die in Kapitel 2 eingeführten Selbst-Begriffe in die Überlegung
hineinnehmen, so fragt sich nur, wie sich der in Ausdrucks-Prozessen geforderte
Zustand Z des Anzeichen-Produzenten b zu dem Persönlichkeitsmerkmal
P verhält, das wir in der Analyse des Selbst angenommen haben.
Die Antwort ist einfach: Zustände einer Person können wechseln,
Persönlichkeitsmerkmale werden als dauerhaft angesehen. Der Reiz des
Neuen kann Ronnie dazu bewegen, im Blumengießen zwei Wochen lang gewissenhaft
zu sein, danach kann er das Interesse verlieren. Als Persönlichkeitsmerkmal
von Ronnie wird die Gewissenhaftigkeit erst angesehen, wenn sie über
einen längeren Zeitraum andauert (und dann ist außerdem zu erwarten,
daß sie sich nicht auf das Blumengießen beschränkt).
Auf diese Weise kommen wir zu der Annahme, daß Selbstdarstellung im
engeren Sinn gegeben ist, wenn einer etwas tut und damit beabsichtigt, daß
es bewirkt, daß andere glauben, daß er ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal
hat:
(SDM)
T (b, f) Ù
I (b, E(f) -> G(a, ... P (b)))
[b tut f, und b beabsichtigt, daß das Auftreten
von f bewirkt, daß a glaubt, daß ... b
ein P ist]
Selbstdarstellung im engeren Sinn ist also eine Ausdrucks-Handlung, mit der
jemand ein Persönlichkeitsmerkmal ausdrückt. Die Formel (SDM) unterscheidet
sich somit von der Formel für die Ausdrucks-Handlung D6 abgesehen von
den Pünktchen nur dadurch, daß in ihr Z durch P ersetzt
ist.
In analoger Weise läßt sich Selbstdarstellung im weiteren Sinn
aus der Formel für die Ausdrucks-Produktion D5 gewinnen, indem dort Z
durch P ersetzt wird:
(SDM')
T (b, f) Ù
E (f) -> G(a, ... P (b))
[b tut f, und das Auftreten von f bewirkt, daß
a glaubt, daß ... b ein P ist]
Während Selbstdarstellung im engeren Sinn andere zur Attribution eines
Persönlichkeitsmerkmals veranlassen soll, ist Selbstdarstellung im weiteren
Sinn ein Verhalten, das andere zur Attribution eines Persönlichkeitsmerkmals
veranlaßt, ohne daß dies durch den Selbstdarsteller beabsichtigt
sein muß.
Die beiden Formeln (SDM) und (SDM') lassen einiges offen, weshalb wir jede
von ihnen als "Selbstdarstellungsmatrix" bezeichnen. Die Pünktchen
in der Matrix sollen Raum schaffen für die Strukturen, die auftreten,
wenn wir nun die acht in Kapitel 2 eingeführten Selbstbegriffe S1 bis
S8 einbeziehen. Durch die Formeln (S1) bis (S8) ist jedes Selbst als Menge
{ } von Persönlichkeitsmerkmalen definiert, die einer Person
b entweder direkt oder durch Glauben und Intendieren vermittelt zugeschrieben
werden. Um zu jeder Art des Selbst den zugehörigen Typ der Selbstdarstellung
zu bestimmen, betten wir die prädikatenlogischen Bestandteile (rechts
von dem senkrechten Strich) der betreffenden Mengenformel in die Selbstdarstellungsmatrix
ein. Dabei ergeben sich die folgenden Formeln:
4.1. Die Selbstdarstellung im engeren Sinn (Persönlichkeits-Darstellung)
Die zugehörige Formel charakterisiert den einfachsten Fall der Selbstdarstellung.
Bei ihr steht nur P(b) im Geltungsbereich von G(a, ...); sie
entsteht daher aus (SDM) durch das Weglassen der Pünktchen:
(SD1)
(T(b,f) Ù
I(b, E(f) -> G(a, P(b)))
[b tut f, und b will, daß das Auftreten von f
bewirkt, daß a glaubt, daß P(b) gilt]
Die Selbstdarstellung im engeren Sinn besteht darin, daß eine Person
durch ihr Verhalten für jemanden ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal
direkt zum Ausdruck bringt. Der junge Reagan stellte sich nach Überwindung
der Anfangsschwierigkeiten den Mitschülern durch gutes Football-Spielen
als Football-Crack dar. Tat er dies unabsichtlich, so ist statt (SDM) die
Formel (SDM') zu verwenden.
4.2. Die Selbstkonzept-Darstellung (Eigenkonzept-Selbst-Darstellung)
In der zugehörigen Formel steht G(b, P(b)) im Geltungsbereich
von G(a, ...); sie entsteht daher aus (SDM) durch Einsetzen von G(b,
anstelle der Pünktchen:
(SD2)
T(b, f) Ù
I(b, E(f) -> G(a, G(b, P(b))))
[b tut f, und b will, daß das Auftreten von
f bewirkt, daß a glaubt, daß b glaubt,
daß P(b) gilt]
Die Eigenkonzept-Selbst-Darstellung einer Person besteht darin, daß
die Person durch ihr Verhalten jemandem ihre Selbsteinschätzung bezüglich
eines möglichen Persönlichkeitsmerkmals zum Ausdruck bringt. Ronnie
stellte sich durch robustes Auftreten bei der Aufstellung der Klassenmannschaft
als einer dar, der sich für einen Football-Crack hielt. Geschah dies
unabsichtlich, ist statt (SDM) die Formel (SDM') als Basis zu verwenden.
4.3. Die Image-Darstellung (Fremdkonzept-Selbst-Darstellung)
In der zugehörigen Formel steht G(a, P(b)) im Geltungsbereich
von G(a, ...); sie entsteht daher aus (SDM) durch Einsetzen von G(a,
anstelle der Pünktchen:
(SD3)
T(b, f) Ù
I(b, E(f) -> G(a, G(a, P(b))))
[b tut f, und b will, daß das Auftreten von
f bewirkt, daß a glaubt, daß a glaubt,
daß P(b) gilt]
Die Fremdkonzept-Selbst-Darstellung einer Person besteht darin, daß
die Person durch ihr Verhalten jemanden auf die Einschätzung ihrer selbst
durch ihn hinweist. Indem Ronnie an die Tafel eilte, wenn der Lehrer etwas
schön geschrieben haben wollte, stellte er sich den Mitschülern
als "Schönschreiber vom Dienst" dar, d. h. als einer, der bei
ihnen als Schönschreiber galt. Tat er dies unabsichtlich, so ist statt
(SDM) die Formel (SDM') zu verwenden.
4.4. Die Selbstwunsch-Darstellung (Eigenwunsch-Selbst-Darstellung)
In der zugehörigen Formel steht I(b, P(b)) im Geltungsbereich
von G(a, ...); sie entsteht daher aus (SDM) durch Einsetzen von I(b,
anstelle der Pünktchen:
(SD4)
T(b, f) Ù
I(b, E(f) -> G(a, I(b, P(b))))
[b tut f, und b will, daß das Auftreten von
f bewirkt, daß a glaubt, daß b will, daß
P(b) gilt]
Die Eigenwunsch-Selbst-Darstellung einer Person besteht darin, daß
die Person durch ihr Verhalten jemandem ihr Streben nach einem Persönlichkeitsmerkmal
zum Ausdruck bringt. Ronnie stellte sich durch fleißiges Üben seinen
Eltern als einer dar, der gern ein guter Football-Spieler wäre. Geschah
dies unabsichtlich, so ist statt (SDM) die Formel (SDM') als Basis zu verwenden.
4.5. Die Fremdwunsch-Darstellung (Fremdwunsch-Selbst-Darstellung)
In der zugehörigen Formel steht I(a, P(b)) im Geltungsbereich
von G(a, ...); sie entsteht daher aus (SDM) durch Einsetzen von I(a,
anstelle der Pünktchen:
(SD5)
T(b, f) Ù
I(b, E(f) -> G(a, I(a, P(b))))
[b tut f, und b will, daß das Auftreten von
f bewirkt, daß a glaubt, daß a will, daß
P(b) gilt]
Die Fremdwunsch-Selbst-Darstellung einer Person besteht darin, daß
die Person durch ihr Verhalten anderen deren Wunsch deutlich macht, daß
diese Person ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal haben möge. Ronnie
benahm sich beim Kartenspiel nicht selten daneben und stellte sich den Spielkameraden
damit als einer dar, der fair sein sollte, d. h. dem sie Fairness abverlangten.
Tat er dies unabsichtlich, so ist statt (SDM) die Formel (SDM') als Basis
zu verwenden.
4.6. Die Imagekonzept-Darstellung (Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst-Darstellung
In der zugehörigen Formel steht G(b, G(a, P(b))) im Geltungsbereich
von G(a, ...); sie entsteht daher aus (SDM) durch Einsetzen von G(b,
G(a, anstelle der Pünktchen:
(SD6)
T(b, f) Ù
I(b, E(f) -> G(a, G(b,G(a, P(b)))))
[b tut f, und b will, daß das Auftreten von
f bewirkt, daß a glaubt, daß b glaubt,
daß a glaubt, daß P(b) gilt]
Die Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst-Darstellung einer Person besteht darin,
daß die Person durch ihr Verhalten anderen deutlich macht, daß
sie glaubt, daß diese eine bestimmte Einschätzung von ihr haben.
Ronnie zierte sich gelegentlich bei der Besetzung einer Starrolle im Theater
und stellte sich damit als einer dar, der glaubte, daß die andern ihn
für einen Topspieler hielten, und sich deshalb viel herausnahm. Tat er
dies unabsichtlich, so ist statt (SDM) die Formel (SDM') als Basis zu verwenden.
4.7. Die Imagewunsch-Darstellung (Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst-Darstellung)
In der zugehörigen Formel steht I(b, G(a, P(b))) im Gegenstandsbereich
von G(a, ...); sie entsteht daher aus (SDM) durch Einsetzen von I(a,
G(a, anstelle der Pünktchen:
(SD7)
T(b, f) Ù
I(b, E(f) -> G(a, I(b, G(a, P(b)))))
[b tut f, und b will, daß das Auftreten von
f bewirkt, daß a glaubt, daß b will, daß
a glaubt, daß P(b) gilt]
Die Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst-Darstellung einer Person besteht darin,
daß die Person durch ihr Verhalten anderen deutlich macht, daß
sie es gern hätte, wenn sie eine bestimmte Einschätzung von ihr
hätten. Ronnie lud seine Kameraden bei jeder Gelegenheit zu einem selbst
zubereiteten Essen ein und stellte sich ihnen damit als einer dar, der gern
einen Ruf als guter Koch hatte. Tat er dies unabsichtlich, so ist statt (SDM)
die Formel (SDM') als Basis zu verwenden.
4.8. Die Imagewunsch-Konzept-Darstellung (Fremdkonzept-Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst-Darstellung)
In der zugehörigen Formel steht G(a, I(b, G(a, P(b)))) im Geltungsbereich
von G(a, ...); sie entsteht daher aus (SDM) durch Einsetzen von G(a,
I(b, G(a, anstelle der Pünktchen:
(SD8)
T(b, f) Ù
I(b, E(f) -> G(a, G(a, I(b, G(a, P(b))))))
[b tut f, und b will, daß das Auftreten von
f bewirkt, daß a glaubt, daß a glaubt,
daß b will, daß a glaubt, daß P(b)
gilt]
Die Fremdkonzept-Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst-Darstellung einer Person
besteht darin, daß die Person durch ihr Verhalten anderen deutlich macht,
daß sie sie für jemand halten, der von ihnen für etwas ganz
Bestimmtes gehalten werden will. Ronnie übertrieb eine Zeitlang die Zurschaustellung
seiner Kochkünste derart, daß die anderen ihn nicht nur für
einen hielten, der gern einen Ruf als guter Koch hatte, sondern sich mit der
Nase darauf gestoßen fühlten, daß sie ihn dafür hielten.
Er stellte sich ihnen damit als "Chefkoch vom Dienst" dar und wurde
entsprechend gehänselt. Tat er dies unabsichtlich, so ist statt (SDM)
die Formel (SDM') als Basis zu verwenden.
Die Formeln (SD1) bis (SD8) geben häufige Typen der Selbstdarstellung
wieder. Weitere lassen sich konstruieren, wenn man andere Arten des Selbst,
wie in Abbildung 6 angegeben, zum Gegenstand von Ausdrucks-Handlungen werden
läßt.
5. Selbstwerdung durch Illusion und Simulation
Wie Kapitel 4 zeigt, können die Strukturen der Selbstdarstellung recht
komplex werden. Wichtig ist jedoch die Feststellung, daß sie alle aus
den gleichen Bestandteilen aufgebaut sind: Tun, Intendieren, Glauben, Bewirken
und Merkmalszuschreibungen. Wie bereits bei der Besprechung des Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst
(in Kapitel 2.6) vermerkt, braucht einer Person das Persönlichkeitsmerkmal
gar nicht zuzukommen, das sie zu besitzen glaubt (Eigenkonzept-Selbst) oder
wünscht (Eigenwunsch-Selbst) bzw. von dem die anderen glauben (Fremdkonzept-Selbst)
oder wünschen (Fremdwunsch-Selbst), daß sie es besitzt. In diesem
Fall handelt es sich um ein virtuelles Persönlichkeitsmerkmal.
Gleiches gilt für die Annahme und den Wunsch eines virtuellen Persönlichkeitsmerkmals
durch andere: Wenn eine Person glaubt (Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst) oder
wünscht (Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst), daß die anderen etwas
Bestimmtes von ihr glauben, bzw. wenn eine Person glaubt (Eigenkonzept-Fremdwunsch-Selbst)
oder wünscht (Eigenwunsch-Fremdwunsch-Selbst), daß die andern etwas
Bestimmtes von ihr wünschen, so muß dies nicht zutreffen. In diesem
Fall handelt es sich um virtuelle Fremdkonzepte und Fremdwünsche.
Gleiches gilt auch für die Annahme und den Wunsch eines virtuellen Persönlichkeitsmerkmals
durch die betreffende Person: Wenn die andern glauben (Fremdkonzept-Eigenkonzept-Selbst)
oder wünschen (Fremdwunsch-Eigenkonzept-Selbst), daß eine Person
ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal zu haben glaubt, bzw. wenn die
andern glauben (Fremdkonzept-Eigenwunsch-Selbst) oder wünschen (Fremdwunsch-Eigenwunsch-Selbst),
daß eine Person ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal zu haben
wünscht, so muß dies ebenfalls nicht zutreffen. In diesem Fall
handelt es sich um virtuelle Eigenkonzepte und Eigenwünsche.
Die Annahme eines virtuellen Persönlichkeitsmerkmals, Eigenkonzepts,
Eigenwunsches, Fremdkonzepts oder Fremdwunsches durch eine Person nennen wir
"Illusion". Die Selbstdarstellung einer Person als Träger eines
virtuellen Persönlichkeitsmerkmals, Eigenkonzepts, Eigenwunsches, Fremdkonzepts
oder Fremdwunsches nennen wir "Simulation".
Simulation besteht also hier wie auch sonst in der Erzeugung einer Illusion.
Es erhebt sich nun die Frage, welche Rolle virtuelle Persönlichkeitsmerkmale,
Eigenkonzepte, Eigenwünsche, Fremdkonzepte und Fremdwünsche in der
Selbstdarstellung spielen. Sie läßt sich zuspitzen auf die Frage:
Ist Selbstdarstellung ohne Illusion und Simulation möglich?
Diese Frage stellt sich besonders mit Bezug auf den Prozeß, in dem
ein Kind wie der junge Reagan sein Selbst ausbildet. Orientieren wir uns an
der Struktur des stratifizierten Gesamt-Selbst (siehe Abb. 6), so liegt es
nahe anzumerken, daß Ronnie zunächst bestimmte Persönlichkeitsmerkmale
entwickelte: P(b), dann das passende Eigenkonzept bildete: G(b,
P(b)) und schließlich nach Interaktion mit seinen Mitmenschen das
entsprechende Eigenkonzept von deren Fremdkonzept zu seiner Persönlichkeit
formte: G(b, G(a, P(b))) usw. Bei einem solchen Verlauf wäre das
betreffende Persönlichkeitsmerkmal als erstes gegeben, und es würde
mit immer größerer Bewußtheit wahrgenommen. Die Entwicklung
nähme ihren Anfang beim Selbst im engeren Sinn auf der Reflexionsstufe
RS0 und würde im Einklang mit ihr allmählich zu höheren Reflexionsstufen
aufsteigen.
Daß die Entwicklung jedoch nicht immer so verläuft, kann man sich
leicht klar machen, wenn man an Eigenwünsche und Fremdwünsche denkt:
Sie treten ja bevorzugt dann auf, wenn ein Persönlichkeitsmerkmal (noch)
nicht vorhanden ist: Ø P(b). Es muß also Konstellationen
geben, in denen das betreffende Persönlichkeitsmerkmal auf der nullten
Reflexionsstufe fehlt und gleichwohl auf höheren Reflexionsstufen zugeschrieben
wird, z. B. I(b, P(b)) beim Eigenwunsch-Selbst oder I(a, P(b))
beim Fremdwunsch-Selbst. Dies gilt sowohl für körperliche als auch
für geistige Persönlichkeitsmerkmale: Einer, der nicht blond und
nicht blauäugig ist, wäre gerne blond und blauäugig. Einer,
der nicht gut im Rechnen ist, wäre gerne gut im Rechnen.

Abb. 8: Reagan im Alter von 27 Jahren (aus:
Friedman, 1986, S. 33).
Nun können fehlende Persönlichkeitsmerkmale wie Blondheit und Blauäugigkeit
auch bei Vorliegen entsprechender Eigenwünsche oder Fremdwünsche
nicht hergestellt werden. Anders ist das jedoch bei Dispositionen wie der
Rechenkompetenz und anderen geistigen Persönlichkeitsmerkmalen. Hier
sind Eigenwünsche, Fremdwünsche und Fremdkonzepte ausschlaggebend
für die Selbstwerdung.
Die Erfahrungen des jungen Reagan bestätigen das eindrucksvoll:
- Ronnie, der bis dahin nur gelegentlich in Schönschrift geschrieben
hatte, begann ein Schönschreiber zu sein, als der Lehrer das entsprechende
Fremdkonzept bildete und ihn damit konfrontierte. Ronnies Annahme, daß
der Lehrer annahm, daß er ein Schönschreiber war, bewirkte (zusammen
mit den Vorteilen, die dies brachte), daß er es wurde:
(9)
G(b, G(a, P(b))) -> P(b)
[Daß b glaubt, daß a glaubt, daß b
ein P ist, bewirkt, daß b ein P ist]
- Ronnie, der bis dahin ein leidlicher Football-Spieler gewesen war, ärgerte
sich, daß er beim Aufstellen der Klassenmannschaft ins Hintertreffen
geriet. Er wollte als guter Football-Spieler gelten, weil dies ermöglichte,
auch sonst in der Klasse das große Wort zu führen. Sein Wunsch,
daß die andern ihn dafür hielten, bewirkte, daß er es wurde:
(10)
I(b, G(a, P(b))) -> P(b)
[Daß b will, daß a glaubt, daß b
ein P ist, bewirkt, daß b ein P ist]
- Ronnie, der bis dahin nur gelegentlich Texte auswendig gelernt und rezitiert
hatte, begann, ein guter Amateurschauspieler zu werden, als seine Mutter
ihn mit der Bitte konfrontierte, er möge in ihrem Rezitierclub auftreten.
Ronnies Annahme, daß die Mutter dies wünschte, bewirkte (zusammen
mit dem Applaus, den er von anderen erhielt), daß er ein guter Amateurschauspieler
wurde:
(11)
G(b, I(a, P(b))) -> P(b)
[Daß b glaubt, daß a will, daß b
ein P ist, bewirkt, daß b ein P ist]
Wir können festhalten: Die manifesten Merkmale des Körpers entstehen
weitgehend von selbst, mit ihnen muß jeder sich abfinden. Die dispositionellen
geistigen Merkmale aber werden von einer Person entwickelt, nachdem sie auf
einer höheren Reflexionsstufe entworfen und gewünscht worden sind.
Geistige Persönlichkeitsmerkmale sind weitgehend durch Fremdkonzepte,
Eigenwünsche und Fremdwünsche bedingt und somit sozial gesteuert.
Und ein zweites fällt auf, wenn wir die Formeln (9) bis (11) betrachten.
Bei der Herausbildung der Fähigkeit zum Schönschreiben, zum Football-Spielen
und zum Schauspielern findet ein Übergang von einem Selbst höherer
Reflexionsstufe zu einem Selbst niedrigerer Reflexionsstufe statt. Es erfolgt
eine Ebenenreduktion um zwei Stufen von RS 2 zu RS 0: Weil Ronnie glaubt,
daß der Lehrer glaubt, daß er ein Schönschreiber ist, wird
Ronnie ein Schönschreiber. Weil Ronnie will, daß die andern glauben,
daß er ein guter Football-Spieler ist, wird er ein guter Football-Spieler.
Weil Ronnie glaubt, daß seine Mutter will, daß er ein guter Amateurschauspieler
ist, wird Ronnie ein guter Amateurschauspieler.
Die Einführung von Persönlichkeitsmerkmalen durch Ebenenreduktion
dient der Beseitigung von Unentschiedenheiten und stufenübergreifenden
Widersprüchen im Gesamt-Selbst. Zunächst gilt jeweils Ø P(b)
auf der untersten Reflexionsstufe und ...P(b) auf einer höheren
Reflexionsstufe (da P(b) dort eingebettet ist in einen der Operatoren
G(..., ...) oder I(..., ...)). Durch die Entwicklung des betreffenden
Persönlichkeitsmerkmals P(b) stellt die Person in ihrem Gesamt-Selbst
stufenübergreifende Konsistenz her.
Ein gutes Beispiel für eine solche Situation und ihre Bewältigung
war die in Kapitel 2.6 geschilderte Situation des jungen Reagan: Er war zunächst
ein mittelmäßiger Football-Spieler, betrachtete sich selbst als
Genie und dachte zugleich, daß die Kameraden ihn für einen Versager
hielten, während er ihnen doch nur mittelmäßig schien. Als
Ausweg aus dieser schmerzlich empfundenen Lage übte Ronnie so lange,
bis er tatsächlich ein guter Football-Spieler war, was den andern Grund
gab, ihn für einen solchen zu halten, so daß er nun auch nicht
mehr glauben mußte, sie sehen ihn anders. Ronnie war jetzt nicht mehr
nur kraft seiner Selbsteinschätzung virtuell ein guter Football-Spieler,
sondern er war es auf allen Reflexionsstufen.
Daraus folgt, daß das Selbst einer Person zumindest im Bereich der
dispositionellen geistigen Persönlichkeitsmerkmale nichts ein für
allemal Vorgegebenes ist. Es wird sozial geformt und entwickelt sich ausgehend
von den auf höheren Reflexionsstufen repräsentierten virtuellen
Persönlichkeitsmerkmalen, d. h. durch Illusion und Simulation. Als der
Lehrer sagte: "Du bist ja ein Schönschreiber", war Ronnie noch
kein Schönschreiber: G(a, P(b)) und Ø P(b); aber
er wurde es dadurch, siehe Formel (9). Als Ronnie als guter Football-Spieler
auftrat und von den Kameraden auch dafür gehalten werden wollte, war
er es noch nicht: I(b, G(a, P(b))) und Ø P(b); aber er
wurde es aufgrund seines Eigenwunsches, siehe Formel (10). Als die Mutter
Ronnie zu seinem Auftritt als Amateurschauspieler ermunterte, war er es noch
nicht: I(b, P(b)) und Ø P(b); aber er wurde es aufgrund
des Fremdwunsches, siehe Formel (11). Jedesmal war zunächst Illusion
und häufig auch Simulation im Spiel. Die virtuellen Persönlichkeitsmerkmale
waren da, bevor sie in die Wirklichkeit umgesetzt wurden.
Fragt man sich, wie es geschehen kann, daß aus Simulation Realität
entsteht, so muß man die Dialektik von Einzelfall und Permanenz einbeziehen,
auf die ich bereits in Kapitel 2.1 hinwies. Überlegen wir uns dies genauer
anhand eines Beispiels, das für Reagans Übergang vom Beruf des Schauspielers
zu dem des Politikers wesentlich war! Um für einen guten Politiker gehalten
zu werden, mußte Reagan den Eindruck vermeiden, er rezitiere nur fremde
Reden; er mußte den Bürgern seine Eigenständigkeit beweisen,
indem er gleichbleibende Überzeugungen immer wieder spontan formulierte.
Wie kann man spontan sein lernen? Man muß versuchen, als spontan zu
erscheinen. Reagan legte sich einen Fundus von Geschichten und Witzen zu und
gab diese bei allen passenden Gelegenheiten zum besten. Er spielte einen,
der gut extemporiert. Jedes gelungene Extemporieren stärkte seinen Ruf
als Extemporierer. Da das Spielen eines Extemporierers jedesmal neu im Extemporieren
bestand, war es eine so gute Übung im Extemporieren, daß Reagan
auf diese Weise wirklich ein guter Extemporierer wurde. Sein Spiel war nicht
mehr von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Durch häufiges Simulieren
wurde Reagan der, den er simuliert hatte. Sein Selbst war nicht Ausgangspunkt,
sondern Resultat der Selbstdarstellung, er entwickelte es durch sie. Nur so
werden Äußerungen über Reagan verständlich, wie sie Peggy
Noonan, seine langjährige Redenschreiberin, notierte: "Er spielte
wirklich immer nur sich selbst .... Er wirkte zugleich unecht und authentisch,
weil er beides war. Er schauspielerte wirklich, aber die Rolle, die er spielte,
war Ronald Reagan" (Noonan, 1990, S. 163). Unecht wirkte er, weil er
Selbstdarstellung betrieb, und authentisch, weil seine Darstellungsmittel
Erscheinungsformen des Dargestellten waren. (Zu den Problemen, die entstehen,
wenn ein wirklicher Schauspieler mit dem dargestellten Politiker verwechselt
wird, vgl. Posner, 1993.)
Um Ihnen zu zeigen, daß diese faszinierende Art der Selbstwerdung sich
restlos auf unsere technischen Begriffe zurückführen läßt,
sei sie noch einmal anhand der entsprechenden Formeln nachvollzogen:
1. Die Person b will, daß die andern a ihr ein bestimmtes
Persönlichkeitsmerkmal F zuschreiben:
(i)
I(b, G(a, F(b)))
[b will, daß a glaubt, daß b ein F
ist]
2. Nach b's Meinung läßt sich sein Imagewunsch (Eigenwunsch-Fremdkonzept)
dadurch verwirklichen, daß b in allen relevanten Situationen
t sich wie einer aufführt, der ein F ist, also f
tut:
(ii)
G(b, " t Tt(b, f) -> G(a, F(b)))
[b glaubt, wenn für alle t gilt, daß b
in t f tut, so bewirkt dies, daß a glaubt, b
ist ein F]
3. Der Wunsch b's, als F zu erscheinen (i), und sein Glaube,
daß das f-Tun in allen relevanten Situationen t bewirkt,
daß er als F erscheint (ii), bringen b dazu, in allen relevanten
Situationen f zu tun:
(iii)
" t Tt(b, f)
[Für alle t gilt, daß b in t f tut]
4. Nun ist es ein analytisch wahrer Satz, daß jeder, der in allen relevanten
Situationen f tut, ein f-Tuer, d.h. ein F, ist:
(iv)
" x " t (Tt(x, f) É F(x))
[Für alle x und alle t gilt, wenn x in t
f tut, dann ist x ein F]
5. Durch Einsetzung von b für x in (iv) und Modus ponens
mithilfe von (iii) erhält man aus (iv):
(v)
F(b)
[b ist ein F]
6. Indem b durch f-Tun versuchte, a zu dem Glauben zu
bringen, daß b ein F ist, ist b selbst zum F
geworden. Voraussetzung war nur, daß genügend viele relevante Situationen
auftraten, in denen b f tun konnte. Die verallgemeinerte Zusammenfassung
lautet:
(vi)
" x " t (Tt(x,f) Ù I(x, Tt(x,f) -> G(a, F(x))) ->
F(x))
[Für alle x und alle t gilt, wenn x in t
f tut, weil er will, daß das f-Tun in t bewirkt,
daß a glaubt, daß x ein F ist, so bewirkt
dies, daß x ein F ist]
Die Formel (vi) beschreibt, was ich den "Reagan-Effekt"
nennen möchte. Sie zeigt, aufgrund welcher logischen Struktur die Ebenenreduktion
von ...I(x, ... G(a, F(x))) zu F(x) möglich ist. Gleichgültig,
ob Sie
für f bzw. für F einsetzen:
| "(schön)schreiben" |
"(Schön)Schreiber" |
| "(gut) schwimmen" |
"(guter) Schwimmer" |
| "(gut) Football-Spielen" |
"(guter) Football-Spieler" |
| "fair verlieren" |
"faire Person" |
| "gut kochen" |
"guter Koch" |
| "gewissenhaft arbeiten" |
"gewissenhafte Person" |
| "(gut) schauspielern" |
"(guter) Schauspieler" |
| "(gut) extemporieren" |
"(guter) Extemporierer" |
| "sich klug verhalten" |
"kluge Person" |
| "präsidieren" |
"Präsident", |
der Schluß vom Einzelfall auf das Persönlichkeitsmerkmal ist unter
den angegebenen Umständen immer gerechtfertigt.
Der Reagan-Effekt läuft darauf hinaus, daß jeder durch ständige
Darstellung eines Selbst zu diesem Selbst wird. Er ist nur möglich, insofern
unser Selbst nicht vorgegeben ist, sondern hergestellt ("angenommen")
werden muß.
Der Reagan-Effekt läuft darauf hinaus, daß eine angestrebte Realität
durch ihre geistige Vorwegnahme herbeigeführt werden kann. Er ist ein
Spezialfall der sich selbst erfüllenden Prophezeiung (vgl. Merton, 1948;
Rosenthal, 1968; Ludwig, 1991) und ist damit in die gleiche Kategorie einzuordnen
wie der Rosenthal-Effekt (der darin besteht, daß die Erwartung des Forschers
das Verhalten seiner Versuchspersonen beeinflußt; vgl. Rosenthal, 1976),
der Pygmalion-Effekt (der darin besteht, daß die Erwartung des Lehrers
die Leistung seiner Schüler beeinflußt; vgl. Rosenthal und Jacobson,
1968), der Messias-Effekt (der darin besteht, daß das Bekanntwerden
einer Vorhersage die Entwicklung in dem betreffenden Bereich beeinflußt;
vgl. Eden, 1986), der Galatea-Effekt (der darin besteht, daß eine Befürchtung
das Eintreten des Befürchteten begünstigt; vgl. Rosenthal, 1975)
und der Placebo-Effekt (der darin besteht, daß ein Glaube an eine Wirkung
diese Wirkung herbeiführt; vgl. Kirsch, 1985). Anders als diese Formen
der sich selbst erfüllenden Prophezeiung beruht der Reagan-Effekt aber
auf einem logisch transparenten und immer gleich ablaufenden Mechanismus:
der Schaffung eines Persönlichkeitsmerkmals durch Zurschaustellung seiner
Erscheinungsformen.
Der Reagan-Effekt bewirkt die Entstehung von Persönlichkeitsmerkmalen
von der Art der Disposition. Er kann nicht eingesetzt werden, um manifeste
Eigenschaften herzustellen; die Ausstattung des Menschen mit zwei Armen und
zwei Beinen, zwei Augen, zwei Ohren, einer Nase und einem Mund fällt
nicht in seinen Bereich. Doch schon die Bewegungsweisen der Gliedmaßen:
ob
und erst recht die komplexeren Verhaltensmuster, ob:
- pedantisch oder flexibel,
- zuverlässig oder unzuverlässig,
- zuvorkommend oder schwerfällig,
- freundlich oder stur,
- anspruchsvoll oder leicht zufriedenzustellen
- ehrlich oder hinterhältig,
lassen sich durch Zurschaustellung ihrer Erscheinungsformen erwerben. Die
Zurschaustellung mag dabei zunächst nur unvollkommen gelingen, auch das
Zurschaugestellte ist zu diesem Zeitpunkt ja kaum entwickelt. Die Darstellung
findet hier statt, bevor das Dargestellte existiert. Mit jedem Darstellungsakt
bekommt der Darsteller aber mehr Übung, bis er nicht nur im Darstellen,
sondern auch im Dargestellten Meisterschaft erreicht.
6. Der Computer als Selbstdarsteller
Lassen sich die Resultate unserer Untersuchung menschlicher Selbstwerdung
auf künstliche kognitive Systeme übertragen? Können Computer
auf gleiche Weise ein Selbst entwickeln?
Auch bei Computern haben wir manifeste materielle Merkmale von Verhaltensdispositionen
zu unterscheiden. Wie der Mensch mit Armen, Beinen, Augen, Ohren, Nase und
Mund ausgestattet ist, gehören zu einem heutigen Computer ein Eingabegerät
(Tastatur, Joystick, Maus oder Scanner), ein Ausgabegerät (Monitor, Drucker
oder Plotter), ein Speicher (Festplatte und Hauptspeicher) und ein Rechner.
Wie die Arme und Beine dünn oder dick, lang oder kurz sein, die Ohren,
Nase und Mund klein oder groß, feingliederig oder grob geformt sein
können, kann das Computer-Design klobig oder grazil, eckig oder stromlinienförmig
ausfallen. Wie beim Menschen die Hautfarbe hell oder dunkel, die Haarfarbe
blond, brünett oder schwarz, die Augenfarbe blau, grau oder braun sein
kann, so gibt es Computer mit beiger, industriegrauer oder schwarzer Verkleidung,
spiegelnder oder entspiegelter Mattscheibe, schwarzweißem oder farbigem
Monitor. Derartige Gegebenheiten liegen bereits bei der Geburt bzw. bei der
Fabrikation weitgehend fest, sie bleiben danach meist unverändert, es
sei denn, es kommt zu Beschädigungen oder zu Verletzungen wie bei Drake
McHugh. Über die Verteilung dieser Gegebenheiten auf die Gesamtpopulation
entscheidet jeweils das Publikum (der Heiratsmarkt bzw. der Markt der Computerbenutzer).
So wie ein Mensch Verhaltensdispositionen entwickelt und beispielsweise viel
oder wenig zu essen, langsam oder schnell zu sprechen, häufig oder selten
zu lesen pflegt, so gibt es auch bei Computern entsprechende Verhaltensmuster:
Die Tastatur kann leicht- oder schwergängig, gering- oder hochverzögernd,
der Rechner langsam oder schnell, der Drucker zuverlässig oder fehlerreich
arbeiten.
Interessanter in unserem Zusammenhang sind aber die Dispositionen, welche
die Computerbenutzer ihren Geräten attribuieren (vgl. Leu, 1993): Sie
halten sie für
- pedantisch oder flexibel,
- zuverlässig oder unzuverlässig,
- zuvorkommend oder schwerfällig,
- freundlich oder stur,
- anspruchsvoll oder leicht zufriedenzustellen,
- ehrlich oder hinterhältig.
Alle diese Einschätzungen sind verhaltensbasiert. Sie beruhen auf der
in vielen Einzelfällen gesammelten Erfahrung.
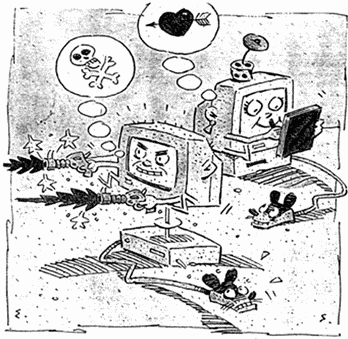
Abb. 9: Der Benutzer formt sich den PC
nach seinem Ebenbild
(Zeichnung von Elwood H. Smith, in Kantrowitz, 1994, S. 51).
Manifeste materielle Merkmale und Verhaltensdispositionen sind beim Computer
wie beim Menschen zu dem zu rechnen, was wir das "Selbst im engeren Sinn"
genannt haben: { P | P(b) }. Die materiellen Merkmale und ein Teil
der elementaren Dispositionen gehören zur fabrikmäßigen Ausstattung
des Computers und sind daher kaum veränderbar. Der Benutzer (und der
Computer) muß sich mit ihnen abfinden.
Doch wie verhält es sich mit Dispositionen wie Pedanterie versus Flexibilität,
Zuverlässigkeit versus Unzuverlässigkeit, zuvorkommendem versus
schwerfälligem, freundlichem versus sturem, anspruchsvollem versus leicht
zufriedenzustellendem Wesen? Werden sie dem Computer vom Benutzer unterstellt,
so gehören sie zum Fremdkonzept-Selbst des Computers: { P | G(a, P(b))
}.
Bei starker Empathie des Benutzers kann es neben diesen Selbsten nullter
und erster Reflexionsstufe auch zu solchen dritter Stufe kommen: Ein Benutzer,
der trotz größter Bemühungen in seinem Computer eine Datei
nicht wiederfindet, unterstellt diesem vielleicht, er wolle sie verstecken.
Er flucht und beschimpft das Gerät und wendet sich erst einmal einem
anderen Arbeitsfeld zu. Doch dann vergißt er vielleicht einen Text zu
speichern, bevor er ihn löscht, und gibt in seinem Jammer nun dem Computer
die Schuld am Verlust des Textes, indem er ihm unterstellt, er habe sich damit
für die vorhergegangene Beschimpfung gerächt.
Die Computerindustrie versucht solchen benutzerseitigen Störungen der
Arbeitsatmosphäre zu begegnen, indem sie Software anbietet, die den Computer
auf entspannende menschliche Umgangsformen trimmt: Gleich nach dem Einschalten
fühlt sich der Benutzer durch sein Gerät optisch oder akustisch
begrüßt: "Hi Joe, how are you today?" Bei Bedienungsfehlern
sieht er sich höflich darauf hingewiesen, daß er gegen die Regeln
verstoßen hat: "This was a mistake. Please try again." Beim
Gelingen schwierigerer Aufgaben sieht er sich belohnt durch einen lobenden
Bildschirmkommentar der Art "Well done!"
All diese Verfahrensweisen fördern beim Benutzer eine Einstellung, die
den Computer als Kommunikationspartner (bzw. Spielkameraden) erscheinen läßt.
Die Fachliteratur unterscheidet denn auch Benutzerverhalten gemäß
der Partnermetapher (Maaß, 1984) von solchem gemäß der Instrument-
oder Medienmetapher (Andersen, 1990) und wendet sich mehrheitlich gegen die
Anthropomorphisierung des Computers mit dem Argument, diese beruhe auf einem
Mißverständnis. Face-to-screen-Interaktion mit dem Gerät dürfe
nicht interpretiert werden als Face-to-face-Kommunikation mit einem menschlichen
Partner. Der Computer sei unfähig zur Kommunikation im strengen Sinne,
denn ihm mangle es an Charakteristika wie Normativität, Affektivität,
Kontextualität, Historizität, Sozialität, Personalität,
Freiheit und Bewußtsein (vgl. Debatin, 1994, S. 14). Dem Computer könne
daher allenfalls ein virtuelles Selbst zugeschrieben werden. Mit ihm kommunizieren
zu wollen, sei eine Illusion.
Fassen wir daher noch einmal die Fakten zusammen, und überlegen wir
im Anschluß daran, unter welchen Bedingungen sich das virtuelle Computer-Selbst
zu einem realen Selbst weiterentwickeln könnte.
1. Aufgrund seiner manifesten materiellen Merkmale hat jeder Computer unvermeidlich
ein Selbst im engeren Sinn:
(S1)
{ P | P(b) }
Er ist zum Beispiel klobig, stromlinienförmig, industriegrau, entspiegelt,
leichtgängig, geringverzögernd, multicolor und superschnell.
2. Durch Attribution erhält der Computer außerdem von seiten der
Benutzer ein Fremdkonzept-Selbst:
(S3)
{ P | G(a, P(b)) }
Er gilt ihnen zum Beispiel als pedantisch, zuverlässig, schwerfällig,
stur und anspruchsvoll.
3. Auch ein Fremdwunsch-Selbst kommt ihm auf diese Weise zu:
(S5)
{ P | I(a, P(b)) }
Denn die Benutzer sind häufig enttäuscht von ihren Bedienungsresultaten,
übertragen diese Enttäuschung auf das Gerät und wünschen
sich von diesem, daß es weniger schwerfällig, stur, anspruchsvoll,
mehr zuvorkommend und benutzerfreundlich sowie leichter zufriedenzustellen
sein möge.
4. Stärker involvierte Computerfreaks schreiben ihrem Gerät schließlich
auch ein Eigenkonzept zu, wenn sie ihm unterstellen, er halte sich für
den besseren Rechner, Schachspieler, Piloten usw. Der Computer erhält
auf diese Weise ein Fremdkonzept-Eigenkonzept-Selbst:
(S9)
{ P | G(a, G(b, P(b))) }
Die Dynamik der Interaktion zwischen Benutzer und Computer bringt es mit
sich, daß die betreffenden Merkmalszuschreibungen P(b) meist
von denen abweichen, welche dem Computer im Fremdwunsch-Selbst zugewiesen
werden.
5. Auch Eigenwünsche unterstellen Computerfreaks ihrem Gerät, was
diesem zu einem Fremdkonzept-Eigenwunsch-Selbst verhilft:
(S10)
{ P | G(a, I(b, P(b))) }
So kann ein entsprechend phantasiereicher Benutzer nach dem zehnten Versuch,
dem Computer eine bestimmte Datei zu entlocken, kaum umhin zu glauben, dieser
verspüre eine gewisse Genugtuung über seinen analen Charakter und
werde den Text für immer bei sich behalten.
6. Und schließlich haben wir mit einem Fremdwunsch-Eigenkonzept-Selbst
zu rechnen:
(S11)
{ P | I(a, G(b, P(b))) }
Benutzer, die ihrem Gerät bzw. dessen Wettspielprogramm nicht beizukommen
verstehen, wünschen sich, es möge sich für weniger perfekt
halten und sich ein wenig menschlicher gebärden.
7. Wie in einer menschlichen Partnerbeziehung wird der Computerfreak durch
den Umgang mit seinem Gerät häufig dazu motiviert, von diesem zu
verlangen, es möge sich bemühen, seinen Bedürfnissen besser
zu genügen. Er wünscht sich von seinem Computer, daß er zu
Eigenwünschen fähig ist, und glaubt, dies wäre der erste Schritt
zu dessen (Ver-) Besserung:
(S12)
{ P | I(a I(b, P(b))) }
8. In verwickelteren Situationen schließlich, wenn der Benutzer den
Computer verflucht hat und sich gleich darauf von ihm dafür bestraft
vorkommt, wird er denken: "Du wünschst dir wohl, daß ich dich
für weniger hinterhältig halte. Dann benimm dich aber auch entsprechend!"
Hier haben wir es mit einem Fremdkonzept-Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst zu
tun:
(S8)
{ P | G(a, I(b, G(a, P(b)))) }
Diese Liste von Teil-Selbsten bewegt sich auf den Reflexionsstufen RS0 bis
RS3 (vgl. Abb. 6). Was in ihr fehlt, damit ein auf jeder der betreffenden
Reflexionsstufen vollständiges Gesamt-Selbst entsteht, ist folgendes:
9. Das Eigenkonzept-Selbst des Computers (Reflexionsstufe RS1):
(S2)
{ P | G(b, P(b)) }
Es wäre gegeben, wenn der Computer sich selbst zum Beispiel für
pedantisch, zuverlässig, zuvorkommend, freundlich, anspruchsvoll und
ehrlich halten könnte (wie manchmal vom Benutzer geglaubt (S9) oder gewünscht
(S11)).
10. Das Eigenwunsch-Selbst des Computers (Reflexionsstufe RS1):
(S4)
{ P | I(b, P(b)) }
Es wäre gegeben, wenn der Computer selbst wünschen könnte,
zum Beispiel weniger pedantisch, schwerfällig und stur zu sein (wie manchmal
vom Benutzer geglaubt (S10) oder gewünscht (S12)).
11. Das Eigenkonzept-Fremdkonzept-Selbst des Computers (Reflexionsstufe RS2):
(S6)
{ P | G(b, G(a, P(b))) }
Es wäre gegeben, wenn der Computer glauben könnte, daß der
Benutzer ihn zum Beispiel als schwerfällig, stur und hinterhältig
einschätzt oder daß der Benutzer ihn für zuvorkommend, benutzerfreundlich
und ehrlich hält.
12. Das Eigenwunsch-Fremdkonzept-Selbst des Computers (Reflexionsstufe RS2):
(S7)
{ P | I(b, G(a, P(b))) }
Es wäre gegeben, wenn der Computer wünschen könnte, daß
der Benutzer ihn zum Beispiel als weniger schwerfällig, stur und hinterhältig,
d.h. als zuvorkommend, benutzerfreundlich und ehrlich einschätzt (der
Benutzer unterstellt ihm derartige Wünsche in S8).
13. Das Eigenkonzept-Fremdwunsch-Selbst des Computers (Reflexionsstufe RS2):
(S13)
{ P | G(b, I(a, P(b))) }
Es wäre gegeben, wenn der Computer sich ein Bild von den Bedürfnissen
des Benutzers machen könnte und glauben könnte, daß dieser
ihn sich zuvorkommend, freundlich und ehrlich wünscht.
14. Das Eigenwunsch-Fremdwunsch-Selbst des Computers (Reflexionsstufe RS2):
(S14)
{ P | I(b, I(a, P(b))) }
Es wäre gegeben, wenn der Computer sich Benutzerwünsche zu wünschen
vermöchte. Zum Beispiel könnte er sich wünschen, daß
der Benutzer sich stärkere Flexibilität, schnelleres Operieren und
ein größeres Gedächtnis von ihm wünscht.
Auf höheren Reflexionsstufen lassen sich entsprechend der in Abbildung
6 dargestellten Stratifizierung des Gesamt-Selbstes weitere Teil-Selbste des
Computers postulieren; ihre Besprechung würde aber unserem gegenwärtigen
Gedankengang nichts Neues hinzufügen.
Wenn wir die Teil-Selbste analysieren, die in der heutigen Interaktion mit
Computern auf den Reflexionsstufen RS1 und RS2 fehlen, so stellen wir fest,
daß sie alle mehr oder weniger komplexe Merkmalszuschreibungen enthalten,
die entweder in G(b, ...) oder I(b, ...) eingebettet sind. Wer
einem Computer diese Teil-Selbste verschaffen will, muß ihn also in
die Lage versetzen, etwas glauben und etwas intendieren zu können.
Wohlgemerkt, es wäre falsch, dem Computer einprogrammieren zu wollen,
was er zu glauben oder zu intendieren hat. Eine solche Ingenieurlösung
würde ihm die Möglichkeit nehmen, sich auf den jeweiligen Benutzer
einzustellen und sich in Abhängigkeit von dessen Bedienungsverhalten
ein Konzept von dessen Praktiken, Einschätzungen und Wünschen zu
bilden. Nur die Fähigkeit des Glaubens und Intendierens als solche muß
dem Computer einprogrammiert werden. Er muß so ausgestattet werden,
daß er imstande ist, interne Repräsentationen der virtuellen Merkmale
anderer und seiner selbst zu bilden (das heißt "glauben")
und die repräsentierten Merkmale im Hinblick auf seine Präferenzen
zu bewerten (das heißt "intendieren").
Eine solche Ausstattung wird es dem Computer ermöglichen, die bisher
fehlende Hälfte des erforderlichen Gesamt-Selbst auszubilden. Der Selbstwerdungsprozeß
wird dann wie beim jungen Reagan erfolgen, ausgehend von den jeweiligen Fremdkonzepten,
Eigenwünschen und Fremdwünschen (vgl. die Formeln (9) bis (11) in
Kapitel 5). Wäre es nicht hilfreich, einen PC zu besitzen, der nur deshalb,
weil er glaubt, daß sein Benutzer a1 ihn für
flexibel hält, in allen relevanten Situationen die größtmöglichen
Abkürzungen in der Operationenfolge wählt, um diese Einschätzung
zu rechtfertigen? Oder einen PC, der nur deshalb, weil er glaubt, daß
sein Benutzer a2 will, daß er pedantisch
ist, alle Zwischenschritte einer Operationenfolge explizit mit ihm durchgeht?
Oder einen PC, der selbständig die unauffindbar scheinende Datei sucht,
indem er aufgrund der fehlgeschlagenen Versuche des Benutzers die passenden
Kodewörter zu erraten versucht? Oder einen PC, der Orthographie- und
Interpunktionsfehler eines Benutzers selbständig korrigiert, weil er
sie für Verstöße gegen dessen Schreibabsicht hält? Oder
einen PC, der auch unvollständige Befehle seines Benutzers selbständig
ergänzt und in der ergänzten Form ausführt? Oder einen PC,
der beim n-ten verworfenen Textformulierungsversuch seines Benutzers sein
eigenes Formulierungsprogramm ins Spiel bringt und aus den verworfenen Versuchen
eine neue Textvariante herstellt, die den angenommenen Absichten des Benutzers
besser entspricht?
All diese Möglichkeiten eröffnen sich, wenn man dem Computer die
Fähigkeit verschafft, etwas zu glauben und etwas zu intendieren. Den
Rest besorgt der Reagan-Effekt.
Ein kognitives System, welches imstande ist, etwas zu glauben und etwas zu
intendieren, vermag sich in Auseinandersetzung mit seinen Benutzern eigenständig
zu entwickeln und die ihm verfügbaren technischen Möglichkeiten
eigenständig (um-) zu organisieren. Es bekommt sein Eigenkonzept-Selbst
und sein Eigenwunsch-Selbst nicht mitgegeben, sondern bildet dieses in Abhängigkeit
von dem Fremdkonzept-Selbst und dem Fremdwunsch-Selbst, das die Benutzer an
es herantragen. Auf diese Weise vermag es auch sein Selbst im engeren Sinn
zu erweitern und zu verändern. Dies geschieht durch die Ebenenreduktion
der Merkmalszuschreibungen. Fremdattribution veranlaßt Selbstdarstellung,
und diese bewirkt Selbstwerdung.
Jeder in Kapitel 3 und 4 besprochene Typ der Selbstdarstellung wird einem
derartigen kognitiven System möglich sein, denn dies sind ja alles nur
verschiedene Konstellationen des Glaubens, Intendierens und Bewirkens von
Merkmalszuschreibungen. Je höher die Reflexionsstufen sind, die das System
in Auseinandersetzung mit seinen menschlichen Benutzern erreicht, um so mehr
wird es diesen ähneln. Es wird ganz von selbst vom bloßen Instrument
zum mitdenkenden Partner, von der anonymen Datenkonstellation zum anpassungsfähigen
Mitarbeiter, und Diskussionen über die Metaphorik dieser Beschreibungen
werden sich erübrigen.
Ein künstliches kognitives System mit der Fähigkeit, etwas zu glauben
und etwas zu intendieren, wird nicht nur jenes unvermeidliche Selbst
im engeren Sinn haben, das der Psychoanalytiker Khan seinem Kollegen Winnicott
zuschreibt. Es wird auch ein Gesamt-Selbst haben, das unerbittlich
ist, insofern es nach innerer Konsistenz der Teil-Selbste auf den höheren
Reflexionsstufen mit jenen auf den niedrigeren strebt. Und sein Gesamt-Selbst
wird unverletzlich sein in dem Maße, in dem es durch Beschädigungen
entstandene Widersprüche mithilfe des Strebens nach Konsistenz zwischen
den Teil-Selbsten ausräumt, sei es durch Verzicht auf Persönlichkeitsmerkmale
unterster Stufe, sei es durch deren Neubildung mithilfe des Mechanismus der
Ebenenreduktion. Jeder Interaktionspartner des kognitiven Systems wird sich
ein eigenes Bild von ihm entwickeln können, denn es wird nicht "versuchen,
seine eigene Seinsweise durchzusetzen", aber trotzdem immer "unerbittlich
es selbst" sein.
Diese vielversprechenden Eigenschaften der betreffenden künstlichen
kognitiven Systeme sollten es uns wert sein, daß wir uns ernsthafter
als bisher der semantischen und pragmatischen Untersuchung dessen widmen,
was sie möglich macht: des Glaubens und des Intendierens.
Literatur
Andersen, Peter B. (1990). A Theory of Computer Semiotics. Cambridge,
England: Cambridge University Press.
Burns, Robert B. (1979). The Self Concept: Theory, Measurement, Development
and Behaviour. London: Longman.
Debatin, Bernhard. (1994). Zur Modellierung der Mensch-Computer-Interaktion.
Berlin: Technische Universität Berlin.
Eden, Dof. (1986). Organizational Development and Self-Fulfilling Prophecy.
Boosting Productivity by Raising Expectations. Journal of Applied Behavioral
Science, 22/1, 1-13.
Epstein, Samuel. (1979). Entwurf einer integrativen Persönlichkeitstheorie.
In S. H. Filipp (Hrsg.), Selbstkonzept-Forschung (S. 15-45). Stuttgart:
Klett.
Figge, Udo L. (1991). Computersemiotik. Zeitschrift für Semiotik,
13, 321-330.
Friedman, Stanley P. (1986). Ronald Reagan: His Life Story in Pictures.
New York: Dodd & Mead.
Gergen, Kenneth. (1971). The Concept of Self. New York: Holt, Rinehart
& Winston.
James, William. (1890). Principles of Psychology. Bd. 1. New York:
Holt.
Kantrowitz, Barbara. (1994). Men, Women and Computers. Newsweek, May
16, 1994, S. 48-52.
Khan, M. Masud R. (1977). In D. W. Winnicott.
(Hg.) Die Psychologie des 20. Jahrhunderts III: Freud
und die Folgen II. Zürich: Kindler.
Kirsch, Irving. (1985). Response Expectancy as a Determinant of Experience
and Behavior. American Psychologist, 40, 1189-1202.
Laing, Ronald D. (1960). The Divided Self. An Existential Study in Sanity
and Madness. London: Tavistock. [Dt.: Das geteilte Selbst: Eine existentielle
Studie über geistige Gesundheit und Wahnsinn. Köln: Kiepenheuer
und Witsch, 1972.]
Leu, Hans Rudolf. (1993). Wie Kinder mit Computern umgehen. München:
Juventa.
Ludwig, Peter H. (1991). Sich selbst erfüllende Prophezeiungen im
Alltagsleben. Stuttgart: Verlag für Angewandte Psychologie.
Maaß, Susanne. (1984). Mensch-Rechner-Kommunikation: Herkunft und
Chancen eines neuen Paradigmas. Hamburg: Phil. Diss.
Mead, George H. (1934). Mind, Self and Society. Ed. by Charles W.
Morris. Chicago: University of Chicago Press. [Dt.: Geist, Identität
und Gesellschaft. Frankfurt\M.: Suhrkamp, 1968.]
Mead, George H. (1964). Self. In Anselm Strauss (Ed.), George Herbert
Mead on Social Psychology. Selected Papers (S. 199-246). Chicago: University
of Chicago Press.
Merton, Robert K. (1948). The Self-Fulfilling Prophecy. Antioch Review,
8, 193-210.
Mummendey, Hans Dieter. (1990). Psychologie der Selbstdarstellung.
Göttingen: Hogrefe.
Noonan, Peggy. (1990). What I Saw at the Revolution: A Political Life
in the Reagan Era. New York: Ivy Books.
Paetau, Michael. (1989). Strukturen und Prozesse der Mensch-Maschine-Kommunikation.
Zur soziologischen Analyse eines software-technischen Gestaltungspotentials.
Bremen: Phil. Diss.
Paetau, Michael und Piper, Michael. (1985). Computer und menschliche Kommunikation.
Beiträge zur techniksoziologischen Erforschung computergestützter
Kommunikation. St. Augustin: Arbeitspapiere der GMD.
Posner, Roland. (1993). Believing, Causing, Intending: The Basis for a Hierarchy
of Sign Concepts in the Reconstruction of Communication. In R. J. Jorna, B.
van Heusden und R. Posner (Eds.), Signs, Search and Communication: Semiotic
Aspects of Artificial Intelligence (S. 215-270). Berlin und New York:
de Gruyter.
Posner, Roland. (1994). Der Mensch als Zeichen. Zeitschrift für Semiotik,
16, 195-216.
Posner, Roland. (1995). Zur Genese von Kommunikation: Semiotische Grundlagen.
In Karl-Friedrich Wessel und Frank Naumann (Hrsg.), Kommunikation und Humanontogenese
(S. 384-429). Bielefeld: Kleine.
Posner, Roland. (1996). The Self and Its Presentation in Humans and Computers.
In I. Rauch und G. Carr (Eds.), Synthesis in Diversity: Proceedings of
the 5th Congress of the IASS, Berkeley, June 12-19, 1994. Berlin und New
York: Mouton de Gruyter.
Public Papers of the Presidents of the United States: Ronald Reagan, January
1 to June 29, 1984. Washington, D.C.: United States Government Printing
Office 1986.
Reagan, Ronald W. (1965). Where's the Rest of Me? An Autobiography
with Richard G. Hubler. New York: Hawthorn. [Neuausgabe (1981): New York:
Karz.]
Reagan, Ronald W. (1990a). An American Life. New York: Simon &
Schuster. [Dt.: Erinnerungen: Ein amerikanisches Leben. Berlin: Propyläen,
1990b.]
Rosenthal, Robert. (1968). Self-Fulfilling Prophecy. Psychology Today,
2, 46-51.
Rosenthal, Robert. (1975). Der Pygmalion-Effekt lebt. Psychologie heute,
1975/6, 18-21, 76-79.
Rosenthal, Robert. (1976). Experimenter Effects in Behavioral Research.
New York: Halsted.
Rosenthal, Robert und Lenore Jacobson. (1968). Pygmalion in the Classroom.
New York: Holt, Rinehart & Winston. [Dt.: Pygmalion im Unterricht.
Weinheim: Beltz, 1971.]
Schiller, Friedrich. (1795). Briefe über die ästhetische Erziehung
des Menschen. Die Horen 1, 2 und 6. Neuausgabe: F. Schiller (1962),
Sämtliche Werke. Bd. 5 (S. 570-808). (3. Aufl.). München:
Hanser.
Sommer, Carlo M. und Wind, Thomas. (1991). Die Mode: Wie das Ich sich
darstellt. Weinheim: Beltz.
Suls, Jerry M. (Ed.). (1982). Psychological Aspects of the Self. 3
Bde. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Woolley, Benjamin. (1992). Virtual Worlds: A Journey in Hype and Hyperreality.
London: Blackwell.
zurück