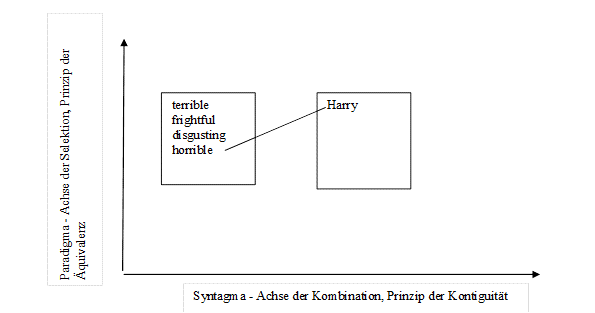|
Julia Genz (Tübingen) und Kayo Adachi-Rabe (Berlin) Übersetzung als po(i)etisches Verfahren: Yoko Tawadas deutsch-japanische Partnertexte Im Bauch des Gotthards, Orangerie und Spiegelbild1Yoko Tawada's texts are known for their uncommon way in applying techniques of translation. This article points out two relevant aspects of translation from two distinct perspectives – a German one and a Japanese one: on the one hand, "translation without original" and, on the other hand, the so called "partnertexts" ("Partnertexte"), i.e., texts first written in German that are then 'translated' into Japanese by the author herself. It can be shown that the effect of a "translation without original" is created by a poetic play with foreign matter from other traditions and other literary genres, which makes it a kind of hybrid text. By contrast, "partnertexts" are in part translated word for word, in part whole periods are removed or added, alluding to two various ways of dealing with 'waste': one can recycle it or dispose it. By combining these two methods, the different traditions in one text enter into a dialogue, according to the sample of the Japanese Zen Buddhistic Kôan. In this sense, translation is akin to a Zen Buddhistic understanding of epiphany. 1 Texte als Reisende 1.1 Reisen und Übersetzen Es gibt wenige literarische Beispiele, für die sich die Reisemetapher so sehr anbietet, ja geradezu aufdrängt, wie für die Texte von Yoko Tawada. Und das nicht nur in dem Sinne, dass diese Texte Reiseerfahrungen thematisieren, dass sie Übersetzer und Übersetzerinnen als Protagonisten haben oder mit Überseezungen betitelt sind. In den Texten von Tawada wimmelt es nicht nur von Reisen und Reisenden, sondern ihre Texte sind Reisende. Reisen Texte meistens als Übersetzungen, so sind auch Tawadas Bücher u.a. ins Französische, Englische, Italienische usw. übersetzt worden. Hier jedoch geht es bei der Metapher von Tawadas Texten als Reisenden einerseits um den Eindruck des Lesers, diese Erzählungen, beispielsweise Spiegelbild, von irgendwoher, aus einer anderen Literaturtradition, zu kennen. Als seien sie Übersetzungen, ohne dass man eine konkrete Textgrundlage nennen könnte. Andererseits geht es in Tawadas 'reisenden' Texten weder um die Frage nach dem Ausgangspunkt und Ziel der Reise noch um das Verhältnis von Ausgangs- und Zielsprache, sondern um das Unterwegssein schlechthin. In ihrem Band Überseezungen schreibt sie:
PhiN 69/2014: 2 In ihrer zweiten Tübinger Poetik-Vorlesung spricht sie bezeichnenderweise von Texten, die wie "Übersetzungen ohne Original" (Tawada 1998c: 36) wirken. Dieser Begriff soll zunächst kurz geklärt und die Rolle von Übersetzungen als strukturgebende und textgenerierende Verfahren bei Tawada erläutert werden, bevor wir auf einige ihrer deutsch-japanischen Partnertexte eingehen. 1.2 Die Rolle des Übersetzens in Tawadas Werk Während die herkömmliche Vorstellung von Original und Übersetzung dem Konzept der Interkulturalität in dem Sinne entspricht, dass Texte von einer Ausgangskultur in eine andere reisen, handelt es sich bei der Vorstellung einer Übersetzung ohne Original eher um das Dazwischen, nicht um den Ausgangs- und Endpunkt einer Reise; es geht also eher um ein transkulturelles denn um ein interkulturelles Konzept. Tawadas Verständnis des Übersetzens und das Konzept der Übersetzung ohne Original sind in ihrer Funktionsweise bereits häufiger beschrieben worden (Matsunaga 2002, Choi 2010, Genz 2010, Saito 2010). In diesem Zusammenhang wurde auch auf die strukturalistisch beziehungsweise poststrukturalistisch geprägte Sprachauffassung von Tawada hingewiesen (Choi 2010: 516, Genz 2010: 471ff.). Im Folgenden wird kurz eine strukturalistisch geprägte Herangehensweise an Tawadas Übersetzungsproblematik resümiert, die an anderer Stelle ausführlich erläutert wurde (Genz 2010). Bei herkömmlichen Übersetzungstheorien, ob frei oder wortlautgetreu, geht es zumeist um den propositionalen Gehalt der Texte, der möglichst nachvollziehbar von einer Sprache in die andere übertragen werden sollte. Dabei erreicht man natürlich nie eine Eins-zu-eins-Übersetzung, sondern es kommt auch immer zu Übertragungsverlusten, Änderungen, Bedeutungsanreicherungen etc. Tawadas Poetik des Übersetzens setzt nun nicht an der Semantik des Wortes an, sondern primär an Form und Klang des Wortes. Dies hängt mit einer Eigenschaft des japanischen Schriftsystems zusammen. Die japanische Schrift besteht aus drei Schriftsystemen: den japanischen Silbenschriften Hiragana und Katakana sowie der chinesischen Bilderschrift, also Ideogramme oder Kanji. Die Ideogramme markieren nicht die Aussprache eines Wortes. Bereits innerhalb einer Sprache findet eine Übersetzungsleistung zwischen gelesenem Ideogramm und gesprochenem Wort statt. Japanische Personennamen werden beispielsweise in den chinesisch-japanischen Ideogrammen geschrieben. Gleichklingende Namen können mit unterschiedlichen Ideogrammen geschrieben werden. Nur anhand der Ideogramme kann man die ursprüngliche Bedeutung des Namens ablesen. Schreibt man diese Namen nun in lateinischer Schrift, so klingen diese Namen nicht nur gleich, sie sehen auch gleich aus und bedeuten scheinbar das Gleiche, wie Yoko Tawada in ihrem Essay Metamorphosen der Personennamen schreibt:
PhiN 69/2014: 3 Die Ideogramme speichern also eine Information, die in der Aussprache nicht markiert wird. Durch die Schreibung des Wortes in Alphabetschrift geht diese Information einerseits verloren. Andererseits entstehen die Homonymien von Yoko (Ozean-Kind) und Yoko (Blätter-Kind) erst durch die Transkription in das lateinische Alphabet. Die auf verschiedenen Schriftsystemen beruhende Übersetzung wird zum Ausgangspunkt von Tawadas Verständnis des Übersetzens und des Schreibens. Ihr Text Der Apfel und die Nase reflektiert darüber, wie ein Computer zwischen den Ideogrammen und den Silben- und Alphabetschriften übersetzt:
Dieses Prinzip der Homophonie durch die Alphabetschrift wird nun wesentlich für den Aufbau von Tawadas Erzählungen. Anhand von Roman Jakobsons "poetischer Funktion" lässt sich Tawadas Prinzip veranschaulichen:
Abb. 1: Die poetische Funktion bei Roman Jakobson (Sexl 2004: 167) PhiN 69/2014: 4 Für Jakobsons poetische Funktion spielen Selektion und Kombination eine wichtige Rolle. Abbildung 1 zeigt einen schematisierten Ablauf dieser beiden Prinzipien: Zunächst wird aus mehr oder weniger ähnlichen wertenden Adjektiven wie 'terrible', 'frightful', 'disgusting', 'horrible', die in bestimmter Hinsicht äquivalent sind, ein Wort selektiert und mit dem Eigennamen 'Harry' kombiniert. Die Kombination erzeugt Kontiguität. Die poetische Funktion überträgt das Prinzip der Äquivalenz der Achse der Selektion jedoch auf die Achse der Kombination. Kombiniert wird nun aufgrund von Gleichklang, gleicher Silbenanzahl, gleicher Wortbetonung usw. Im Beispiel aus Abbildung 1 wird 'horrible' mit 'Harry' aufgrund des gleichen Anlauts kombiniert (vgl. Jakobson 2007: 170). In Tawadas Text ist die alphabetische Umschrift von japanischen Wörtern dafür verantwortlich, dass sich Wörter wie 'hana' (Nase) und 'hana' (Blume) aufgrund des Gleichklangs in demselben Paradigma wiederfinden, aus dem dann das Wort ausgewählt wird, das bisher am häufigsten benutzt wird, in diesem Fall 'hana' = 'Nase'. Tawada suggeriert, dass der Computer nach der Auswahl die Bedeutung des Wortes übersetzt und in den syntaktischen Zusammenhang wie einen Fremdkörper einfügt, etwa im Satz "Vielen Dank für die Nase, die Du mir geschenkt hast". Im Fortgang einer für Tawada typischen Erzählung prägt der 'Fremdkörper' dann den Verlauf der Handlung. Geht es um die Häufigkeit von Wörtern, so rufen Wörter wie Nase und Blume auch unterschiedliche Texttraditionen auf. Das Wort 'Nase' kommt z.B. besonders häufig in medizinischen Fachbüchern über Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten vor, das Wort 'Blume' findet man vielleicht eher in Natursachbüchern oder Liebesgeschichten. Damit erzeugen diese Fremdkörper in den Texten oft auch Gattungs- und Genremischungen, Texthybride, die beispielsweise an ein medizinisches Lehrbuch erinnern, gleichzeitig aber auch den Charakter einer Liebesgeschichte haben. Den Satz "Vielen Dank für die Nase, die Du mir geschenkt hast" hat Tawada leider nicht als Erzählung ausgearbeitet. Die Vermischung von Genres lässt sich aber beispielsweise gut anhand des Essays Der Apfel und die Nase aus Überseezungen demonstrieren. In diesem Text werden ein Essay über Computerübersetzungen und die biblische Schöpfungsgeschichte durch fremdkörperartige Schlüsselwörter verschmolzen. In dem Essay geht es zunächst darum, wie man Japanisch auf einem (amerikanischen) Computer schreibt, nämlich indem man die Worte mit der Alphabettastatur so tippt, dass Amerikaner das Wort problemlos aussprechen könnten.
PhiN 69/2014: 5 Das Logo der Firma Apple und eine amerikanische Mac-Userin werden in einer Übersetzungsleistung zum biblischen Apfel und zu Eva. In der Logik des Computers wird die Vorstellung vom Garten Eden durch das Innere des Computers übersetzt. Eva hat sich im Inneren des Computers auf den digitalen Baum der Erkenntnis eingelassen und vom amerikanischen Apple-Logo gegessen. Damit markiert der Computer mit dem Apple-Logo den Sündenfall. Die Folge ist analog zur Vertreibung aus dem Garten Eden ein sich permanentes Fremdfühlen in der Sprache, das zu einer ständigen Übersetzungsleistung zwingt. Dadurch erscheint der Text als Mischgebilde aus einem Essay, der über die Arten des Übersetzens reflektiert, und einem biblischen Text. Das Verfahren, Fremdkörper in Texte einzuschleusen, verselbstständigt sich bei Tawada. Es ist nicht unbedingt an die japanische Sprache oder an eine konkrete Übersetzungsleistung gebunden. Daher ist ihre Rede von der "Übersetzung ohne Original" durchaus ernst zu nehmen: Die Texte werden durch ein Verfahren generiert, das aus der Umschrift des Computers in ein anderes Zeichensystem stammt, es handelt sich also um eine Übersetzungsleistung. Interessanterweise hat Tawada einige Texte, die sie zunächst als Übersetzungen ohne Original konzipiert und auf Deutsch geschrieben hat, später selbst ins Japanische übersetzt. Anhand der Beispiele Im Bauch des Gotthards, Die Orangerie und Spiegelbild lässt sich zeigen, dass Tawada selbst bei diesen deutsch-japanischen Partnertexten zwei verschiedene Konzepte des Übersetzens verwendet: Zunächst einmal gibt es einen Text, der wie eine Übersetzung aus einem Sprachsystem in ein anderes wirkt (also die "Übersetzung ohne Original"). Dieses Übersetzungsverfahren ist rein 'poietisch', dient also der Erzeugung von Texten. Nachträglich wird der Text von Tawada in ihre Muttersprache 'übersetzt': Der Übersetzungsprozess erscheint bei Tawada auf den Kopf gestellt: Beispielsweise wirken die Texte Orangerie und Spiegelbild in der deutschen Fassung wie Übersetzungen ohne Original. Indem Tawada diese Texte nachträglich in ihre Muttersprache übersetzt, scheint sie das 'Original' gleichsam nachzuliefern. Das Original ist bei Tawada also paradoxerweise etwas Sekundäres. Die eigentliche Übersetzungsleistung vom Deutschen ins Japanische, die im folgenden Kapitel behandelt wird, folgt dabei anderen Regeln als die Produktion von Übersetzungen ohne Original. 2 Die deutsch-japanischen Partnertexte 2.1 Im Bauch des Gotthards – Gottoharuto tetsudô Die deutsche Version Im Bauch des Gotthards ist in Form eines kurzen Reise-Essays geschrieben. Der Textinhalt konzentriert sich auf die Oberfläche des Sprachspiels. Die Autorin allegorisiert eine Zugfahrt durch den Gotthard-Tunnel als eine Reise in den Körper eines Mannes namens Gotthard:
PhiN 69/2014: 6 Tawada beschäftigt sich mit dem Geschlechtsbild und dem Personifizierungseffekt des Namens "Gotthard", um ein surrealistisches Sprachspiel zu entfalten. Nicht nur im semantischen, sondern auch im semiotischen Element des Ortsnamens, nämlich in der Form eines Buchstabens, versucht sie, ein Bild zu sehen, als ob es, wie ein chinesisches Schriftzeichen, ein Ideogramm darstellen würde:
Diese Spiele mit den Buchstaben kommen in der japanischen Version aus dem Grund nicht vor, weil sie sich nicht ohne weiteres in das japanische Schriftsystem übertragen lassen. Der muttersprachliche Partnertext ist auf jeden Fall gänzlich anders konzipiert. Er ist viel länger und in Form einer Erzählung geschrieben. Die Beschreibung ist subtiler und subjektiver. Der größte Unterschied zur deutschen Version liegt darin, dass eine persönliche Geschichte der Ich-Erzählerin gleichsam in Form einer 'Rückblende' oder assoziativen Parallelmontage hinzugefügt wurde. Während der Fahrt erinnert sich die Reisende immer wieder an ihren Freund Rainer, weil der Gotthard-Tunnel sie seinen Körper assoziieren lässt. Eine Passage, in der sie sich an Rainer erinnert, lässt sich aus dem Japanischen wie folgt übersetzen:
Die Erzählhandlung mit Rainer wirkt emotional und persönlich. Die detaillierte Schilderung ihrer Gedanken über ihn legt ihre physische Leidenschaft zu ihm offen. In einem Interview äußerte Yoko Tawada:
Wie sie hier offenbart, ist der Fall der Partnertexte Gotthard ein Beispiel für die "Kieselsteine" und das "fließende Wasser". Ein Erlebnis entfaltet sich in der Autorin in zwei unterschiedlichen Welten und Schreibsystemen. PhiN 69/2014: 7 Die japanische Version enthält ein extremes Beispiel für ein unübersetzbares Wortspiel, nämlich am Ende des vorher zitierten Textes: "Auf dem durchwachsenen Fleisch verstreut sich auch der Tod." Auf Japanisch heißt es: "Shimofuri niku ni shi mo furikakaru." Das erste "shimofuri" bedeutet 'gereift'. Man verwendet diesen Ausdruck für durchwachsenes Fleisch, auf dem das Fett ein weißes Muster bildet, als ob es reift. Der zweite, getrennt geschriebene Begriff "shi mo furi (kakaru)" bedeutet etwa: "auch (mo) der Tod (shi) verstreut sich" ("furikakaru", im Sinne von 'heimsuchen'). Das Wortspiel wirkt im Japanischen witzig und poetisch. Der komische Effekt besteht zunächst darin, dass 'gereift' und 'auch der Tod' auf Japanisch homophon sind, obwohl sie keine semantische Verbindung aufweisen, wie es auch beim Wort "hana" ('Blume' und 'Nase') der Fall ist. Überdies wird im Syntagma ein Zusammenhang zwischen einem Terminus des Metzgergewerbes ("gereiftes Fleisch") und einem hochpoetischen Ausdruck ("auch der Tod verstreut sich") hergestellt. Dies ruft eine surreale Bildhaftigkeit hervor. Der komische Effekt vervollständigt sich dadurch, dass der Satz trotz der Verfremdungen eine klare Assoziationskette darstellt, in der die ungesunde Fettleibigkeit von Rainer von seiner Freundin nüchtern, aber kritisch betrachtet wird. Dieses Wortspiel bildet ein Miniaturmodell von Tawadas Übersetzungsstrategie. Sie verfeinert die beiden Sprachen gegenseitig, so dass sie eigene Wortspiele für die jeweiligen Sprachen entwickelt und ihre Unübersetzbarkeit neu entdeckt. Diese Partnertexte werfen die Frage auf, wie weit man sich persönlich in einer Fremdsprache äußern kann oder möchte. Viele Leser, die sich mit einer Fremdsprache täglich auseinandersetzen, beschäftigen vermutlich weitere Fragen, z.B.: Wen möchte die Ich-Erzählerin bzw. die Autorin eigentlich ansprechen oder erreichen? Möchte sie die deutschen Leser eher intellektuell anregen und nicht unbedingt emotional? Oder liegt es an den Eigenschaften der beiden Sprachen, dass sie sie unterschiedlich behandelt? Der Unterschied zwischen den beiden Versionen lässt auf jeden Fall vermuten, dass man, auch wenn man die Fremdsprache perfekt beherrscht, eine gewisse Distanz behält. Tawada scheint tatsächlich die Fremdsprache bewusst als ein Instrument aufzugreifen, um anders denken zu können und dadurch eine andere Dimension in der Muttersprache zu kreieren. 2.2 Die Orangerie – Orenjien nite 2.2.1 Vergleich der deutschen Version und der japanischen Übersetzung Die Partnertexte Die Orangerie und Orenjien nite zeichnen sich im Unterschied zu Im Bauch des Gotthards durch eine ausgeglichene Symmetrie aus. Tawada übersetzt sich hier selbst Wort für Wort. Der Unterschied liegt nur darin, dass die deutsche Version als Gedicht und die japanische als Prosa vorliegt. In der deutschen Version heißt es:
PhiN 69/2014: 8 Die muttersprachliche Version wird hier interlinear übersetzt:
Die deutsche Fassung ist knapp und kleinteilig formuliert, während die japanische die Assoziationen schneller und dynamischer in einem einzigen, langen Satz entfaltet. Dadurch wirkt die Prosafassung poetischer als die Gedichtfassung. Die Interlinearübersetzung macht die Unterschiede zwischen dem Japanischen und dem Deutschen augenfällig. Die auffälligsten elementaren Differenzen werden hier kurz aufgelistet:2 1. Das Japanische kennt keinen Artikel. Es gibt weder Genus noch Kasus bei Artikeln und Substantiven (z.B. nicht "vor dem Fenster" [dem Fenster = Dativ], sondern "Fenster [vor]"). Die Bezüge der Worte (meist Nomen) werden größtenteils durch nachgestellte Partikeln verdeutlicht (z.B. "Rücken auf [dem] drei [der] Männer trägt": Die Partikel "ni" und "no" übernehmen dabei die Funktion, die im Deutschen der Dativ beziehungsweise der Genitiv innehat). 2. Der Ausdruck einer Subjektkonstituente ist nicht obligatorisch (vergleichbar mit dem Spanischen oder dem Italienischen, z.B. "Diese Farbe, irgendwo gesehen, dachte" [weggelassenes ich]). 3. Der Numerus (Singular oder Plural) wird meistens nicht markiert (während die Bezeichnung "Schiffe" in der deutschen Version im Plural steht, zeigt die japanische Entsprechung "fune" keine Quantität an). 4. Im Japanischen wird dem Tempus keine so große Bedeutung beigemessen wie im Deutschen. Die Betonung liegt vielmehr auf dem Ausdruck des Aspekts, also ob ein Vorgang abgeschlossen/vollendet ist oder noch fortdauert. Innerhalb eines Textes wird die Zeit daher nicht immer so einheitlich bzw. differenziert angegeben wie in einem deutschsprachigen Text (z.B.: Der Müllwagen "trägt" drei Männer auf dem Rücken, aber ihre Uniform "hatte" die gleiche Farbe. Zum Thema Aspekt in der japanischen Sprache siehe Kitahara u.a. 1981: 114–117). 5. Es gibt keine festen Interpunktionsregeln. 6. Die Konstituenten (Bestandteile) von deutschen und japanischen Sätzen sind oft gegensätzlich angeordnet. So steht im Japanischen eine Partikel, deren Funktion mit der einer deutschen Präposition vergleichbar ist, nach dem bestimmten Nominalausdruck. Es heißt im Japanischen daher "Hamburg nach" und nicht "nach Hamburg". Einem Wort, das dem Genitiv entsprechend markiert werden soll (z.B. fune 'Schiff'), wird im Japanischen eine Partikel (no) und dann das Bezugswort (z.B. kiteki 'Pfeifen') nachgestellt (fune no kiteki 'das Pfeifen des Schiffs'). PhiN 69/2014: 9 Zwar lässt sich kaum objektiv beurteilen, wie leicht die Muttersprache im Gegensatz zu einer Fremdsprache zu verwenden ist. Yoko Tawada scheint in der japanischen Fassung Orenjien nite dennoch zu demonstrieren, dass Japanisch für sie ein flexibleres Mittel zum Notieren ihres Gedankenstroms ist. Trotzdem bestätigt sich die Vermutung, dass Tawada das Gedicht zuerst auf Deutsch schrieb und dann ins Japanische übersetzt hat, denn die in den beiden Texten dargestellten Assoziationsketten müssen auf Deutsch konzipiert sein, weil sie auf Japanisch nicht funktionieren. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Unterschiede der beiden Sprachversionen:
Bei der wörtlichen Übersetzung geht der Sinn der phonetischen Wortspiele verloren, aber eine mysteriös-lyrische Textwirkung klingt in der japanischen Version nach. Den Ausdruck "Der Schmutz auf dem Papier / Das Schmatzen der Tinte" (Tawada 1997a: 31) z.B. schreibt Tawada auf Japanisch so um: "Schmutz auf dem Papier, das Zungengeräusch der Tinte beim Schmatzen" (Kami no yogore, pecha pecha to shita namezuri suru inku no oto, Tawada 1998b: 190). In einem anderen Fall schreibt sie auf Deutsch "Wischtuch / Das den Wunsch des Schmutzes / Vom Tisch aufnimmt" (Tawada 1997a: 32f.). Auf Japanisch heißt es "Das Wischtuch, das den Traum namens Schmutz vom Tisch abwischt" (Zôkin, yogore to iu yume o têburu kara fukitoru tame ni, Tawada 1998b: 191). Die Selbstübersetzung bei Tawada schafft eine Mutation des Ausdrucks in der japanischen Sprache, indem sprachliche Fremdkörper (wie Schmutz / yogore und Schmatzen / shita namezuri sowie Wisch / fuku und Wunsch / yume) miteinander fusioniert werden. Die Orangerie und Orenjien nite stellen beispielhaft die Frage, die generell bei ihren Texten eine Rolle spielt – von welchem kulturellen Standpunkt aus man sie am besten verstehen kann. Den japanischen Lesern entgeht die Verbindung mit den deutschen Wortspielen. Genauso befremdend wirkt Tawadas Sprachgebrauch vielleicht auch bei vielen deutschen Lesern. Selbst wenn man beide Sprachen und Kulturen kennt, erlebt man Verwirrungen. Bereits die im Titel genannten Begriffe "Orangerie" und "Orenjien" lassen beim Leser unterschiedliche Bilder entstehen. Wenn man die japanische Version liest, sitzen ein Müllmann und ein Mönch am Ende zusammen in einer Orangenplantage unter freiem Himmel, während sie sich in der deutschen Fassung eher in einem großen, sonnigen Glashaus oder sogar in einer Gemäldegalerie befinden, die früher eine Orangerie war. Diese Irritationen gehören auch zu Tawadas Programm des Sprachspiels, bei dem man kein eindeutiges Bild bekommt und sich immer wieder seines eigenen Sprachgefühls vergewissern muss. Ihre Texte bieten eine Vielfalt an Lesarten, die ein intensives Oszillieren zwischen den Kulturen in Gang setzt. PhiN 69/2014: 10 2.2.2 Transkulturelle Momente in der deutschen Fassung Die Erfahrung mit Differenzen und gegenseitigen Befruchtungen zwischen dem Japanischen und dem Deutschen geht auch in die Aussage der deutschen Version ein. Statt einen propositionalen Gehalt möglichst genau von einer Kultur in eine andere hinüberzuretten, fließen beide Kulturen mit ihren differierenden und einander ergänzenden Vorstellungen in eine Textversion ein, wie die folgende Passage aus Die Orangerie verdeutlicht:
Die Farbe Orange der Müllmännerkleidung ruft "das Wort im Schatten wach". Diese Schattenbedeutung soll aber nicht ans Licht geholt werden. Der Frucht, die nicht geschält werden will, rät die Erzählerin "Bleib' ungeschält!" Denn die Trennung von Schale und Frucht macht die Schale zum wertlosen Müll, obwohl sie für die Sprecherin genauso wertvoll ist wie die Frucht selbst: "Deine Schale ist Obst wert". Analog dazu könnte man sagen, dass sich Schale und Fruchtfleisch wie die Vorstellungen zweier Kulturen zueinander verhalten. Nur wenn man im Orange der Müllmänner das Gewand der buddhistischen Mönche als latente Bedeutung mitliest, wird das westliche Wertungsprinzip von Müll und Wertgegenständen als das erkennbar, was die Trennung ursprünglich auch in Europa bedeutete: Müll gab es in früheren Zeiten so gesehen kaum, sondern alte Dinge hatten als Recyclingmaterial ebenfalls ihren Wert. Müll als nutzloses Endprodukt ist eine Kategorie des 19. Jahrhunderts (vgl. dazu Veit 2005/2006). Man erkennt sozusagen nur im Nebeneinanderhalten zweier Kulturmodelle die eigentliche Bedeutung der Dinge. Daher verwundert es auch nicht, wenn die Übersetzung einer Ausgangssprache in eine Zielsprache für Tawada analog dem Wechsel von Obstschale zu Fruchtfleisch nicht aufgeht, quasi immer schon seltsam falsch erscheint. Die Allegorie von Schale und Obst kann auch eine Erklärung dafür liefern, warum Tawada, wie im vorigen Abschnitt gezeigt, einige deutsche Passagen ins Japanische verfremdend übersetzt. Und sie erklärt auch, warum in der Übersetzung einige Passagen wegfallen und andere neu hinzugefügt werden: Tawada führt vor, wie die Übersetzung von einer Ausgangs- in eine Zielsprache gleichsam zu 'Wortmüll' führt. Es gibt Passagen, die ungenutzt fallengelassen werden, die also in der neuen Sprache nicht recycelbar sind oder zwar recycelt werden, aber nicht ganz in die neue Umgebung passen. Zudem führt Tawada das Prinzip von Ausgangs- und Zielsprache ad absurdum, wenn sie einen Text in der Sprache schreibt, die gerade nicht ihre Muttersprache ist, um sie dann in ihre Muttersprache zu übersetzen. Es geht Tawada also gar nicht um die Übersetzung selbst, sondern um das Sichtbarmachen des Prinzips Übersetzung. PhiN 69/2014: 11 Daher imitiert sie in ihrer Selbstübersetzung Übersetzungstraditionen und Übersetzungskonventionen, die zwischen deutschen und asiatischen Texten bestehen, wie sie exemplarisch anhand des Gedichts Nachtgedanken von Li Bai (Jing Ye Si) und seinen deutschen Übersetzungen gezeigt werden können (vgl. Siliang 1992: 88–128). Die Poesie des chinesischen Originals liegt dabei u.a. in der Einfachheit und Ökonomie der Worte und der Reduktion auf wenige Elemente wie Bett – Mond – Denken – Heimat. Die deutschen Übersetzungen (z.B. von Otto Hauser, Hans Bethge und Alfred Forke) passen dagegen den Text durch rhetorische Figuren, Ergänzungen und/oder Reime an westliche Vorstellungen von einem Gedicht an. Sie weisen dabei oft wenig Ähnlichkeit mit dem chinesischen Ausgangstext auf. Yoko Tawada ironisiert nun in ihrer Selbstübersetzung diese Übersetzungskonventionen, indem sie die Gattung Lyrik für die deutsche Version 'reserviert'. Dabei wirkt die lyrische deutsche 'Originalversion' weniger elegant, während die japanische Übersetzung zwar in Prosa erscheint, aber viel 'geschmeidiger' klingt (auch die deutschen Übersetzungen von Li Bais Gedicht klingen oft geschmeidiger und gefälliger, büßen aber damit an Aussagekraft ein). Während Tawada in ihren Übersetzungen ohne Original, also dem Übersetzen als poietischem Verfahren, häufig Gattungshybride erzeugt, beispielsweise Mischgebilde aus Essays und Geschichten, verfährt sie bei der Übersetzung von Orangerie von der Ausgangssprache Deutsch in die Zielsprache Japanisch umgekehrt: Sie trennt die Gattungen strikt – die deutsche Version ist in Gedichtform, die japanische Version ist ein Prosatext. Die Gedanken von Texthybriden und Übersetzungen ohne Original kann man wiederum gut anhand des Textes Spiegelbild verdeutlichen, der im nächsten Abschnitt besprochen wird. 2.3 Spiegelbild 2.3.1 Spiegelbild als hybrider Mythos Spiegelbild beginnt wie ein deutsches Märchen mit der typischen Formel "Es war einmal…". Erzählt wird die Geschichte eines Mönches, der das Spiegelbild des Mondes im Wasser umarmen will. Im weiteren Verlauf der Geschichte geht es dann um Assoziationen zu 'ein Spiegelbild im Wasser umarmen', 'trinken' und 'ertrinken'. Japanische Leser bzw. Leser mit Kenntnissen der chinesischen Literatur assoziieren den Anfang der Geschichte möglicherweise mit einer Überlieferung über den Tod Li Bais:3 Er soll ertrunken sein, als er im betrunkenen Zustand versuchte, den sich im Fluss spiegelnden Mond zu umarmen (vgl. Schwarz 1991: 48). Den europäischen Leser erinnert das Motiv, ein Spiegelbild im Wasser zu umarmen, dagegen eher an den Narziss-Mythos (bekanntlich verliebt sich Narziss in sein eigenes Spiegelbild und ertrinkt bei dem Versuch, es im Wasser zu umarmen). Die Elemente 'Mond' und 'Tempel' der Geschichte weisen den Leser jedoch auch auf einen asiatischen Kontext hin. Es handelt sich bei dem Text wieder um einen Hybriden, der nicht eindeutig einer bestimmten Kultur zuzuordnen ist. Vielmehr sind die Elemente aus beiden Kulturkreisen miteinander in einer neuen Geschichte verschmolzen. Auf die sprachlichen Konnotationen zum 'Ertrinken' geht der nächste Abschnitt ausführlich ein; hier nur so viel, dass Ertrinken im Deutschen negativ konnotiert ist, im Japanischen aber auch positiv besetzt sein kann. Dieser Widerspruch wird in einer Passage im Text direkt ausgetragen: PhiN 69/2014: 12
Man könnte diese Passage so interpretieren, dass zwei Stimmen, die zwei konträre Assoziationen über die Spiegelungen im Wasser vertreten, über den Fortgang der Geschichte streiten. Zum einen scheint ein Verfechter des Narziss-Mythos auf dem Ertrinken des Mönchs zu bestehen, während die zweite Stimme eher von Vorstellungen aus dem Zen-Buddhismus geprägt zu sein scheint. Die abschließende Frage in diesem Abschnitt "Wer sind Sie?" (Tawada 1997b: 18) wird bezeichnenderweise nicht beantwortet; eine eindeutige Identifizierung des oder der Befragten ist nicht möglich. Die befragte Person definiert sich als Leser bzw. Leserin, in dem / der das Gelesene zusammenläuft und eine Eigendynamik entwickelt – ähnlich wie in Roland Barthes' Vorstellung von der Geburt des Lesers aus dem Tod des Autors (Barthes 1994). Es geht hier wiederum nicht um den Urheber des Erzählten, sondern nur um das Unterwegssein des Textes, der in gewisser Weise bei unterschiedlichen Lesern Station macht. 2.3.2 Der Vergleich der deutschen mit der japanischen Version: Spiegelbild – Kyôzô Die Partnertexte Spiegelbild und Kyôzô sind sowohl inhaltlich als auch formal fast identisch geschrieben. Gerade weil sie identisch geschrieben wurden, entsteht eine Reihe von Differenzen. Zum Beispiel: "Er trinkt das Wasser. […] Und er ertrinkt" (Mizu o nomimasu. […] Soshite obore mashita (Tawada 1997b: 18, Tawada 1998a: 9). Das Wortspiel funktioniert auf Japanisch nicht. Trinken und Ertrinken sind die zwei lautlich unterschiedlichen Verben 'nomu' und 'oboreru'. Aber interessanterweise eröffnet das Wort 'oboreru' ('ertrinken') eine andere Assoziation. Es bedeutet auch 'sich etwas hingeben' oder 'in etwas versunken sein' mit einer leicht negativen Nuance. So kann man in Alkohol, Liebe und Spiel so wie in Meditation und Lektüre 'ertrinken'. Auf Letzteres spielt Tawada in folgendem Zitat an:
Man ertrinkt im Wasser, obwohl das Wasser und der Körper für jemanden keine Form haben. Die Bedeutung des Ertrinkens ist dabei jedoch nicht nur negativ besetzt. Jemand wagt im Wasser zu ertrinken beziehungsweise versenkt sich in die Meditation oder Lektüre, da er an die Formlosigkeit des Realen glauben kann. Außerdem prüft Tawada unser Kulturverständnis: "Er [der Mönch] schaut nach links und nach rechts" (Sôryo wa hidari o mite, migi o mimasu) (Tawada 1997b: 18, Tawada 1998a: 10). Dieser Satz spielt auf den Unterschied der Verkehrssysteme in den beiden Ländern an. In Japan gilt Linksverkehr wie in England. Die Fußgänger müssen beim Überqueren der Straße zuerst nach rechts und dann nach links schauen. Die Komik besteht darin, dass ein Mönch, der in einer vormodernen Zeit ohne Auto lebt, sich so verhält wie ein Fußgänger unserer Zeit und dazu noch wie ein nicht japanischer. PhiN 69/2014: 13 Es gibt auch deutsche Wortspiele, die in der japanischen Version absichtlich 'schlecht' übersetzt worden sind:
Das Wort "oberflächlich" klingt in diesem Kontext auf Deutsch seltsam, weil es dem Mond eine menschliche Charaktereigenschaft im Sinne von "leichtfertig" zuschreibt, obwohl der Mond in diesem Kontext nicht anthropomorphisiert wird. Wahrscheinlich liegt das Interesse der Autorin darin, mit der Adjektivbildung "oberflächlich" von "Oberfläche" experimentell umzugehen. Die direkte Übersetzung von "oberflächlich" ("hyômenteki") klingt auf Japanisch unnatürlich westlich und förmlich, sie passt nicht zu dem, was hier gemeint ist. Man könnte z.B. besser sagen: "Der Mond liegt auf der Oberfläche des Wassers". Aber dann verschwindet die Poesie, und wie sollte man den zweiten Satz übersetzen? ("Er ist nicht mehr oberflächlich, wenn er berührt wird".) Tawada ist hier mit der 'Nichttransformierbarkeit' einer Szene konfrontiert, in der ein Wort sich weigert, 'adäquat' zu sein und übersetzt zu werden. Die beiden Sätze
übersetzt Tawada ins Japanische ebenfalls mit Absicht 'umständlich': "Was mich betrifft: so ist da ein Überfluss des Redens und ein Mangel des Schreibens."; "Was mich betrifft: so ist da ein Überfluss des Schwimmens und ein Mangel des Sprechens." In diesen Sätzen soll "watashi wa" nicht wie üblich mit "ich bin" übersetzt werden, weil die Partikel "wa" sich in diesem Fall auf das "ich" nicht als Subjekt, sondern als Satzthema bezieht (siehe Mikami 1960: 8). Tawada aktiviert diesen Sonderfall der japanischen Grammatik und spielt mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad der Übersetzung ins Deutsche. Es ist, als ob man zum ersten Mal eine Fremdsprache zu übersetzen versucht oder das Alta-Vista-Programm bedient. Auch in einer solch mechanischen Art der absichtlich 'naiven' Übersetzung entdeckt Tawada eine Poetizität: "Es werde Licht! Und es ward Geräusch." (Hikari yo nare, sore ga oto ni narimashita. (Tawada 1997b: 21; Tawada 1998a: 15) Tawada übersetzt diese Zeile direkt ins Japanische. Das Bibelzitat aus der Genesis müsste eigentlich auf Japanisch "Hikari are!" ("Sei Licht!") heißen. Es ist, als ob ein Übersetzer ein Zitat direkt übersetzt, ohne dessen Quelle zu kennen. Aber Tawada musste 'fehlerhaft' übersetzen, d.h. "werden" anstatt "sein" verwenden, um das Wortspiel ins Japanische zu übertragen. PhiN 69/2014: 14 Um weitere Besonderheiten der beiden Texte zu erläutern, werden an dieser Stelle die Bedeutung des Mondes für Tawada und zwei mögliche Inspirationsquellen für die Partnertexte erläutert. Die japanische Fassung des Spiegelbildes, Kyôzô, gehört zu Tawadas Erzählsammlung Kitsune-tsuki. Dieser Titel bedeutet "Fuchs-Mond" und "vom Fuchs besessen" zugleich. Im Nachwort schreibt Tawada:
In Ostasien herrschte bis zur Moderne und herrscht zum Teil heute noch der Mondkalender und es gibt eine Tradition, den Vollmond im Herbst zu feiern. Dadurch gibt es zahlreiche Gemälde, Gedichte und Erzählungen, die die Schönheit des Mondes thematisieren. Eins der berühmtesten Beispiele dafür ist das Gedicht Gelage im Mondschein (Xuè Xià Dú Zhuó) von Li Bai, in dem der Sprecher mit seinem Schatten und dem Mond anstößt und eine einsame Frühlingsnacht feiert (vgl. Li Bai 1991: 7). Tawada bezieht sich mit der Geschichte eines Mönchs nicht nur auf die östliche Tradition, sondern auch auf die westliche Vorstellung der Mondsüchtigkeit. Das Nachwort verrät auch, dass die Partnertexte Spiegelbild und Kyôzô im Wesentlichen von ihrer Übersetzungspraxis handeln. Als eine mögliche Inspirationsquelle für diese Partnertexte wäre die Erzählung Kôya Hijiri (Der Mönch aus dem Berg Kôya, 1900) von Kyôka Izumi (1873–1939) zu nennen. Ein mittelalterlicher Mönch auf dem Berg Kôya-san begegnet einer Frau und begleitet sie im nächtlichen Wald, wobei er von ihr zum Baden im See aufgefordert wird. Später erfährt er, dass sie ein Phantom war (Izumi 1990). Die Motive in Tawadas Partnertexten, dass ein Mönch sich nicht entkleiden darf und ein Mädchen nach seinen Spuren sucht, erinnern an die unheimliche Erzählung Kyôkas. Eine weitere, inhaltliche Quelle ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die folgende Passage des Lehrtextes Shôbôgenzô (Die Schatzkammer der Erkenntnis des wahren Dharma) vom japanischen Zen-Meister Dôgen (1200–1253):
PhiN 69/2014: 15 Tawadas Strategie der Texthybride ermöglicht, die Erleuchtung in der buddhistischen Lehre mit ihrer Übersetzungsarbeit gleichzusetzen. Die Wasserspiegelung ist das absolut identische Ebenbild des Mondes ohne Gewicht und Substanz, das endlos und vielfältig übertragbar ist. Auch ein Ausgangstext und dessen Übersetzung sollen so in perfekter, harmonischer Interaktivität zueinander stehen. Tawada führt ihren Text in Form eines Dialogs, der an die Art der zen-buddhistischen, widersinnigen Diskussion im Kôan erinnert, einer Sammlung von zen-buddhistischen Lehrtexten. Dôgens Shôbogenzô liefert ein Muster dafür. Die Dialoge bei Tawada entfalten Diskurse einer Art synästhetischen Sinnesaustausches zwischen Licht und Geräusch, Himmel und Erde, Sehen und Hören. Das Spiel des Austauschs geht so weit, dass der Mönch mit dem Wind seine Hände wäscht, um die Sauberkeit abzuwaschen. Diese Wechselbeziehung der Sinne soll dadurch veranlasst werden, dass sich der Mond auf dem Wasser spiegelt, um sein Wesen in eine andere Form zu übertragen. Der Dialog setzt sich widersprüchlich fort, so dass einer behauptet, der Mönch ertrinke nicht, und der andere insistiert, dass er ertrinke. Wahr und falsch scheinen gleichwertig zu sein. Sie sind jeweils eine Seite der Medaille wie der Mond und seine Wasserspiegelung. Die Diskutanten streiten im Text um folgendes:
So entsteht ein paradoxes Bild eines wahren Spiegelbildes ohne Original. Tawada konzipiert eine Selbstübersetzung, in der ein synästhetischer Sinnesaustausch mit einem Ausgangstext sowie eine paradoxe Reversibilität von 'wahr' und 'falsch' stattfinden. Schließlich soll die Substanzialität des Originals verschwinden, so dass eine eigenständige Übersetzung einer imaginären Vorlage geschaffen wird. Tawada entwirft dazu noch eine umgekehrte Variante des Entgegenkommens, nämlich vom Mond zum Mönch. Dadurch entsteht ebenfalls ein Wortspiel zwischen "Mond" und "Mönch", das die beiden Begriffe austauschbar macht:
Anders als bei Dôgen zerstört der Mond das Wasser. Der Text allegorisiert eine konfliktreiche Interaktion der Sprachen, die gegenseitig übersetzt werden müssen. Tatsächlich kann es solche Fälle geben, in denen der Ausgangstext oder eine privilegierte Sprache die Übersetzung belastet oder nicht zulässt. Wie wir in Tawadas Texten gesehen haben, ist ein derartiger 'katastrophaler' Fall einer Übersetzung bei ihr als Experiment nicht ausgeschlossen. PhiN 69/2014: 16 Dôgens Lehre der Wasserspiegelung des Mondes erinnert an Platons Höhlengleichnis: Im Alltag sieht man nur die Abbilder der wahren Ideen der Seienden, so wie ein Höhlenbewohner nur die Schatten der Dinge sehen kann (Platon 2000: 514a–517a). Dieses Gleichnis wird in der Filmtheorie oft mit der Situation im Kino verglichen, um das Wesen des Films als Medium, das lediglich eine Illusion projiziert, zu erläutern (z.B. Baudry 1986). Genauso kann man die Wasserspiegelung bei Dôgen im Zusammenhang mit Tawadas Text als Projektionsoberfläche der literarischen Medien, nämlich der Sprache selbst und bei ihr auch ganz speziell der Buchstaben, interpretieren. Yoko Tawada ist eine Autorin, die ihr Schaffen konsequent auf die Ebene des Sprachlichen konzentriert. Bei ihrer Selbstübersetzung in den Partnertexten gibt es vielleicht längst weder einen Ausgangstext noch die Priorität einer Sprache, sondern nur eine Projektionsfläche ihrer Idee, die rein sprachlich, und zwar in einer komplexen Form der Mischung von Deutsch und Japanisch, konzipiert ist. Während Platon das Illusionäre der Sinneswelt negativ bewertet, affirmiert Dôgen die Virtualität der Erfahrung einer Erleuchtung. Auch Tawada scheint die Haltung Dôgens zu teilen, um ihr Sprachspiel als Kommunikationsmittel weiterzuentwickeln, um die sprachliche Imagination des Lesers herauszufordern und ihn in ein 'Niemandsland' der Sprache einzuladen. 3 Fazit Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass Tawada Übersetzungen auf zweifache Weise benutzt: Zum einen konzipiert sie ihre Texte als Übersetzungen ohne Original. Diese Wirkung kommt vielfach, wie gezeigt, durch Fremdkörper zustande, die aus anderen Textgattungen oder Traditionen zu stammen scheinen und die in die Texte eingeschleust werden. Die Integration der fremden Textelemente führt zu einer Hybridisierung der Texte, die wie Mischwesen aus verschiedenen Textsorten und Textgattungen wirken. Gerade der Text Spiegelbild wirkt beispielsweise wie ein Hybride, der aus Überlieferungen von Li Bais Tod, zen-buddhistischen Texten, Platons Höhlengleichnis und dem Narziss-Mythos untrennbar zusammengesetzt ist. Damit entspricht die Übersetzung ohne Original dem Konzept der Transkulturalität. Daneben übersetzt Tawada ihre eigenen Texte vom Deutschen ins Japanische. Wie gezeigt, übersetzt Tawada ihre Texte zum Teil wortlautgetreu, zum Teil fügt sie jedoch auch ganze Passagen in den japanischen Texten hinzu oder lässt andere Abschnitte weg. Damit kombiniert sie zwei verschiedene Denkweisen, die des 'Recycelns' oder des ewigen Kreislaufs der Dinge, mit der Vorstellung des 'Mülls' und des Ausscheidens aus dem Kreislauf. Zum Teil übersetzt sie auch bewusst 'fehlerhaft' oder 'umständlich', um in der ungewöhnlichen Übersetzung eine eigene Poesie zu entdecken. Unübersetzbarkeit wird als poetisches und poietisches Prinzip fruchtbar gemacht. Die Texte treten nach dem Muster der zen-buddhistischen, widersinnigen Diskussionen im Kôan in einen Dialog, der die Übersetzungsarbeit mit der Erleuchtung der buddhistischen Lehre vergleicht. Während das Prinzip der Übersetzung ohne Original zu einer Verschmelzung und Hybridisierung führt, löst die Übersetzung vom Deutschen ins Japanische die Hybridisierung z.T. wieder auf. Beispielsweise wird die Gattung Lyrik bei Tawada dem deutschen Text zugeschrieben, während die japanische Übersetzung in Prosa erscheint. Darüber hinaus betonen 'falsch' klingende Übersetzungen den Riss zwischen den Texten in den verschiedenen Einzelsprachen und machen ihre Unübersetzbarkeit sichtbar. PhiN 69/2014: 17 Es geht Tawada also nicht um die Übersetzung des Gehalts der Texte, sondern um die Auseinandersetzung mit dem Prinzip Übersetzen und mit Übersetzungskonventionen. Insofern sind die beiden Methoden des Übersetzens von Tawada nicht grundverschieden. Vielmehr assoziiert sie ihre Übersetzungen vom Deutschen ins Japanische mit dem zen-buddhistischen Gleichnis des Mondes, der sich auf dem Wasser spiegelt, dabei aber nicht nass wird und die Wasserfläche nicht zerstört. Übersetzung und übersetzter Text verhalten sich dabei wie gespiegelter Mond und Wasseroberfläche – dabei ist nicht wichtig, was Original und was Spiegelung ist. So wie der Mond im Text von Tawada nicht als solcher existiert, sondern nur als gespiegeltes Objekt, so existieren ihre Texte nur als Projektionsflächen bestimmter Gedanken, die sich zufällig in Einzelsprachen manifestieren. Bibliographie Primärliteratur Tawada, Yoko (1996): "Im Bauch des Gotthards", in: dies.: Talisman. Tübingen: Konkursbuch, 93–99. Tawada, Yoko (1997a): "Die Orangerie", in: dies.: Aber die Mandarinen müssen heute abend noch geraubt werden. Tübingen: Konkursbuch, 29–42. Tawada, Yoko (1997b): "Spiegelbild": in: dies.: Aber die Mandarinen müssen heute abend noch geraubt werden. Tübingen: Konkursbuch,17–23. Tawada, Yoko (1998a): "Kyôzô", in: dies.: Kitsune tsuki. Tokyo: Shinshokan, 8–20. [1994] Tawada, Yoko (1998b): "Orenjien nite", in: dies.: Kitsune tsuki. Tokyo: Shinshokan, 187–195. [1997] Tawada, Yoko (1998c): Verwandlungen. Tübinger Poetikvorlesungen. Tübingen: Konkursbuch. Tawada, Yoko (1998d): "Atogaki", in: dies.: Kitsune tsuki. Tokyo: Shinshokan, 207–209. Tawada, Yoko (2002a): "Musik der Buchstaben", in: dies.: Überseezungen. Tübingen: Konkursbuch, 32–35. Tawada, Yoko (2002b): "Der Apfel und die Nase", in: dies.: Überseezungen. Tübingen: Konkursbuch, 15–17. Tawada, Yoko (2005): "Gottoharto tetsudô", in: dies.: Gottoharto tetsudô. Tokyo: Kôdansha, 7–39. [1995] Tawada, Yoko (2007): "Metamorphosen der Personennamen", in: Arndt, Susan / Naguschewski, Dirk / Stockhammer, Robert (Hg.): Exophonie. Anders-Sprachigkeit (in) der Literatur. Berlin: Kadmos, 221–228. PhiN 69/2014: 18 Sekundärliteratur Barthes, Roland (1994): "La mort de l'auteur", in: ders.: Œuvres complètes. Bd. II, 1966–1973. Hg. v. Eric Marty. Paris: Editions du Seuil, 491–495. [1967] Baudry, Jean-Louis (1986): "The Apparatus: Metapsychological Approaches to the Impression of Reality in the Cinema", in: Rosen, Philip (Hg.): Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader. New York: Columbia Univ. Press, 299–318. [1975] Choi, Yun-Young (2010): "Übersetzen der Wörtlichkeit. Einige Probleme der Übersetzung und des Schreibens bei Tawada", in: Études germaniques 65. 3, 511–524. Dôgen, Shôbôgenzô (2006): Ausgewählte Schriften. Anders philosophieren aus dem Zen. Übers. v. Ryôsuke Ôhashi und Rolf Elbersfeld. Stuttgart–Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog; Tokyo: Keiô University Press. Genz, Julia (2010): "Yoko Tawadas Poetik des Übersetzens am Beispiel von Überseezungen", in: Études germaniques 65.3, 467–482. Izumi, Kyôka (1990): The Saint of Mt. Koya and The Song of the Troubadour. Übers. v. Stephen W. Kohl. Kanazawa: Committee of the Translation of the Works of Izumi Kyôka. Jakobson, Roman (2007): "Linguistik und Poetik." Übers. v. Stephan Packard, in: ders. Poesie der Grammatik und Grammatik der Poesie. Bd. I. Hg. v. Henrik Birus und Sebastian Donat. Berlin: De Gruyter, 155–216. [1960] Kitahara, Yasuo / Suzuki, Tanjirô / Takeda, Kô / Masubuchi, Tsunekichi / Yamaguchi, Yoshinori (Hg.) (1981): Nihon bunpô jiten. Tokyo: Yûseidô. Li Bai (1991): Li Tai-peh. Hg. v. Orplid & Co., Gesellschaft zur Pflege und Förderung der Poesie. Ausgew. und übertr. von Ernst Schwarz. Berlin: Unabhängige Verlagsbuchhandlung Ackerstrasse. Matsunaga, Miho (2002): "'Schreiben als Übersetzung'. Die Dimension der Übersetzung in den Werken von Yoko Tawada", in: Zeitschrift für Germanistik. 12.3, 533–546. Mikami, Akira (1960): Zô wa hana ga nagai. Nihon bunpô nyûmon. Tokyo: Kuroshio Shuppan. Platon (2000): Der Staat. Übers. und hg. von Karl Vretska. Stuttgart: Reclam. Saito, Yumiko (2010): "Une tentative de double traduction. Analyse du Voyage à Bordeaux (Schwager in Bordeaux) de Yoko Tawada", in: Études germaniques 65.3, 525–534. Schwarz, Ernst (1991): "Nachwort", in: Li Bai: Li Tai-peh. Hg. von Orplid & Co., Gesellschaft zur Pflege und Förderung der Poesie. Ausgew. und übertr. von Ernst Schwarz. Berlin: Unabhängige Verlagsbuchhandlung Ackerstrasse, 46–48. PhiN 69/2014: 19 Sexl, Martin (2004): "Formalistisch-strukturalistische Theorien", in: ders. (Hg.): Einführung in die Literaturtheorie. Wien: WUV, 161–190. Siliang, Xue (1992): Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzung klassischer chinesischer Lyrik ins Deutsche. Heidelberg: Groos. Veit, Ulrich (2005/2006): "Abfall als historische Quelle: Zeugenschaft in der Archäologie", in: parapluie 22. [http://parapluie.de/archiv/zeugenschaft/archaeologie.html, 12.03.2014] 1 Die Kapitel 1, 2.2.2, 2.3.1 und 3 sind von Julia Genz, die Kapitel 2.1, 2.2.1 und 2.3.2 sind von Kayo Adachi-Rabe. 2 Für die linguistische Beratung danken wir Manabu Watanabe und Claudia Waltermann, für Formulierungshilfen bei den Punkten 1–3 und 6 geht der Dank an Paul Gévaudan. 3 Für diesen Hinweis danken wir Claudia Waltermann. |