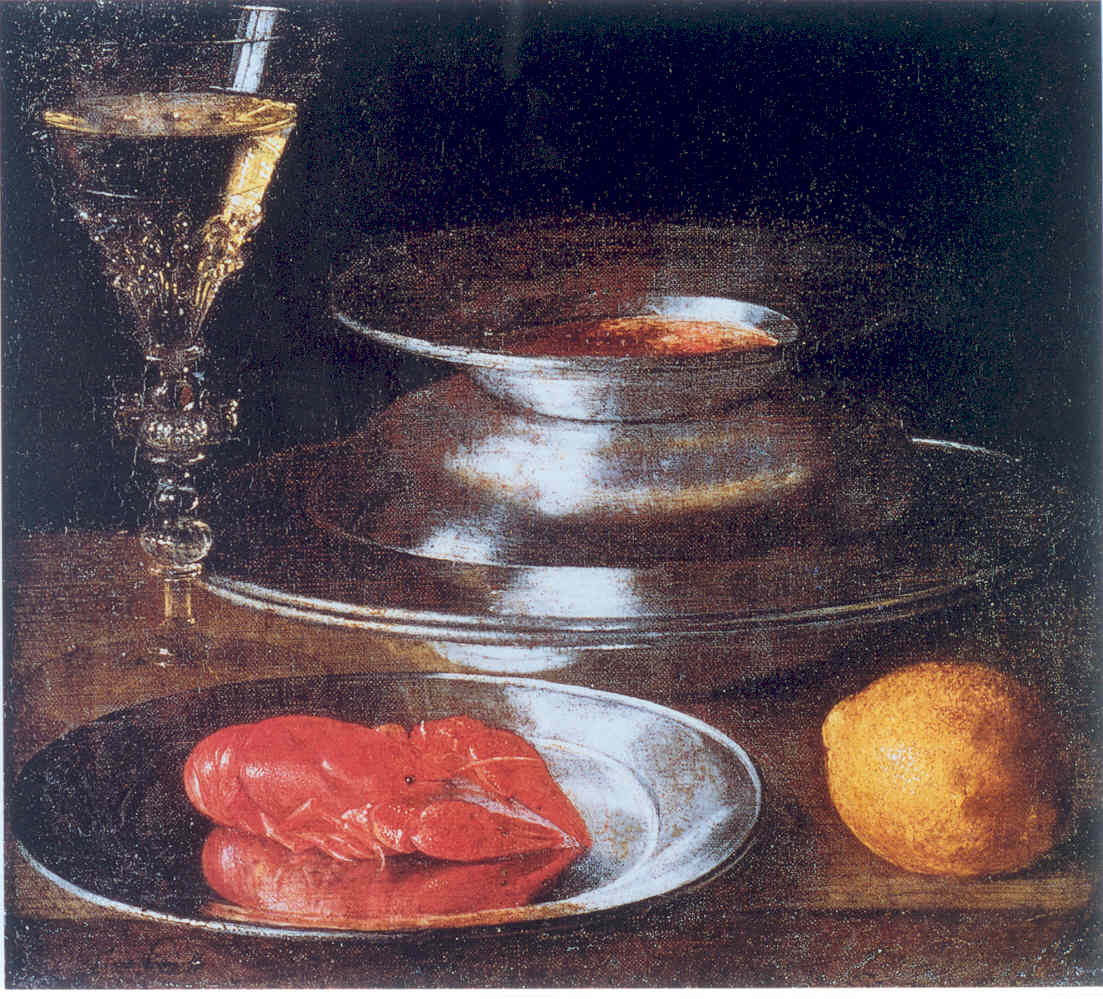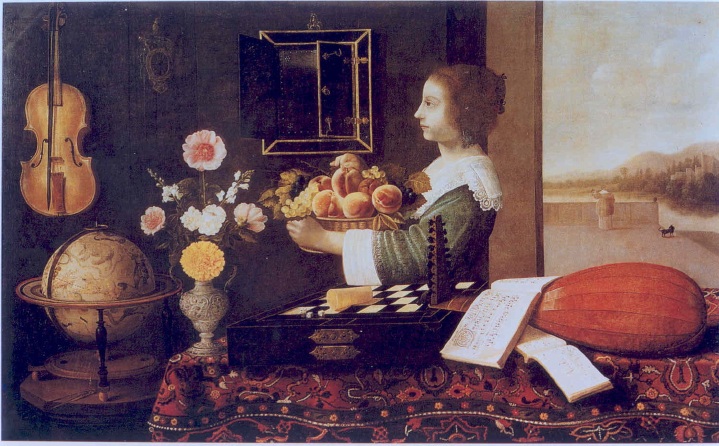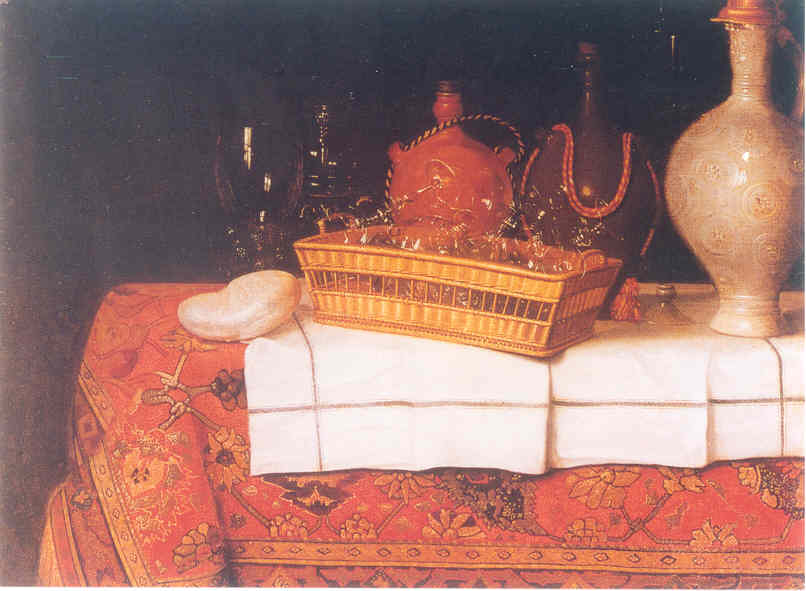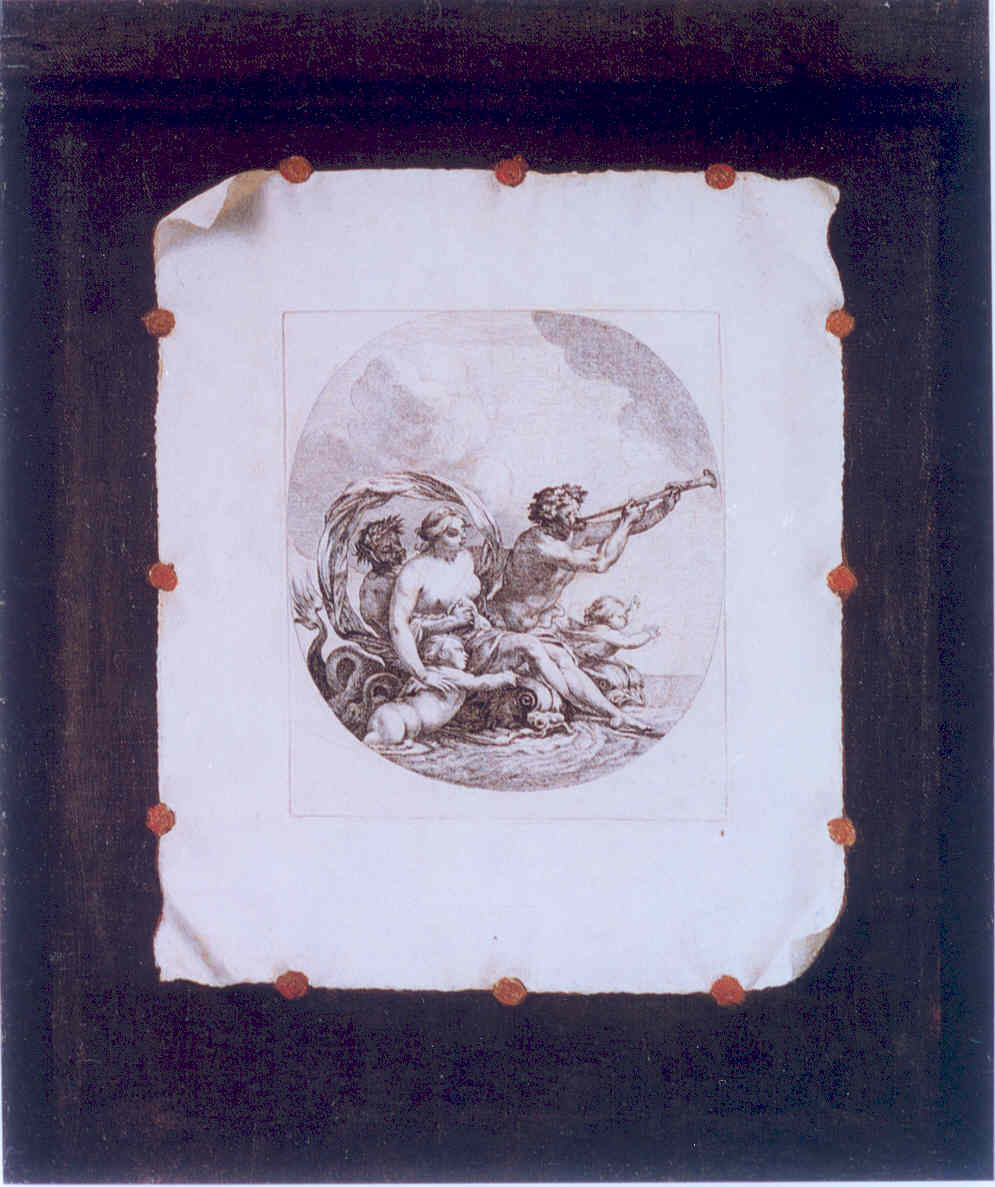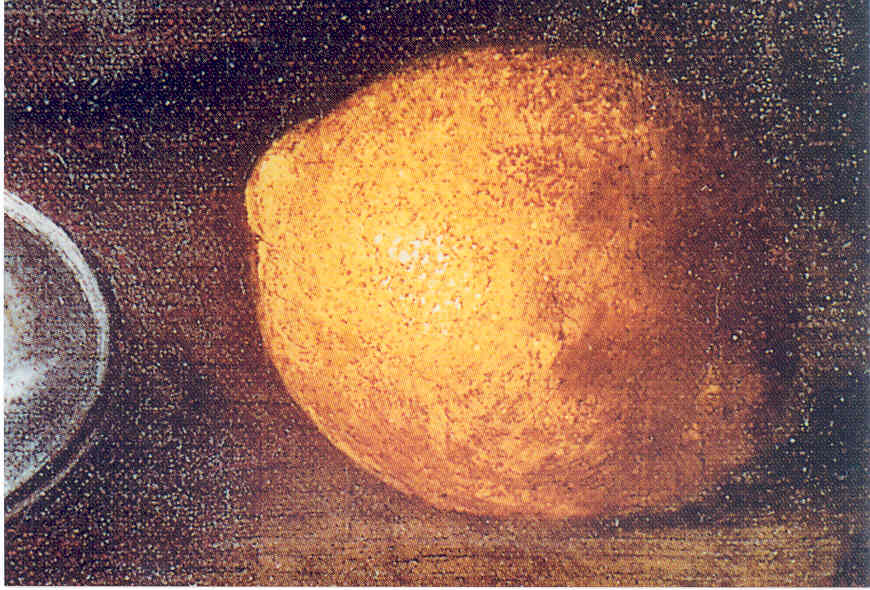|
Beiheft 3/2006 Herausgegeben von Peter Schneck Vanitas vs. optische Sensation Zu den Stilleben von Sebastian Stoskopff (1597–1657)* von Jörg Völlnagel
PhiN-Beiheft 3/2006: 2
VorwortAkademische Vorstellungen, das bilden wir uns heute ein, sind überwunden; wir sind frei, den Künstlern der Vergangenheit all die Freiheiten einzuräumen, die wir angeblich auch den Zeitgenossen gönnen. Doch ganz so ist das nicht: Man braucht nur die herrliche Berliner Gemäldegalerie zu durchschreiten auf der Suche nach einem ihrer eindrucksvollsten Schätze; und man wird das Bild nicht finden; denn es ist zwar groß, aber gerade angesichts seiner Maße ist darauf enttäuschend wenig zu sehen. Der Urheber des Gemäldes ist nicht einmal richtig vergessen, aber auch nicht in Köpfen und Herzen präsent. Vor allem aber passt das Berliner Bild ebenso wenig wie seine anderen Gemälde zu anderen Bildern. Vom Kunstwollen war der Maler vielleicht schlicht nicht vorgesehen, zumal er sich nicht einmal korrekt in eine der nationalen Schulen fügt: Deutschsprachig lebte er vor allem im inzwischen französischen Elsass und in den linksrheinischen Gebieten der heutigen Bundesrepublik. Sein Œuvre könnte gut bei den Holländern Unterschlupf finden; aber dass er nicht zu ihnen gehört, sieht man an jedem Bild. Neben Flegels minutiöse Meisterwerke passen seine Gemälde schon von ihrem erstaunlichen Format her nicht. Kurzum: es ist eben eine Crux mit Sebastian Stoskopff. Zur eigenen Schande muss ich sogar gestehen, dass dieser Sonderling nicht mit einem Wort in meinem eigenen Buch über das Thema seines Lebens, über das Stillleben, vorkommt. Dabei hat die ganze Gattung noch immer einen schweren Stand, so sehr man auch beschreien mag, dass die alten Wertungen nicht mehr gelten. Man nutzt Stillleben als Lückenbüßer in der Galerie, nicht als Anziehungspunkte. Wenn schließlich noch nicht einmal eine schlüssige Botschaft von einem Bild ausgeht, dann fehlt dafür die Geduld. Doch erinnere ich mich mit Begeisterung an einen Nachmittag, als die Berliner Gemälde noch auf Ost und West verteilt waren: Da stellte sich Jörg Völlnagel im Kunsthistorischen Institut ein und meinte, wir müssten unbedingt schnell nach Dahlem; denn da gebe es eine Sensation: Das war der Berliner Stoskopff; den hatte man aus dem Depot geholt und an die Stelle unserer Version des Sebastians von Georges de la Tour gehängt: Der Raum war ideal, auch wenn das Bild fast dessen Dimensionen sprengte: Streng wirkte es, verlangte Muße und eine Sensibilität, die der Autor der nun folgenden Untersuchung in seinen verschiedenen Berufen und in seinem Leben aufzubringen weiß. Das mag er vielleicht mit dem polnischen Autor Zbigniew Herbert gemein haben, der uns manchmal nahe bringt, wenn etwas Wichtiges, etwas Wesentliches geschieht – und sei es auch nur ein ruhiges, statisches Stillleben.
PhiN-Beiheft 3/2006: 3 Eine Studie ist entstanden, die es sich mit dem kunsthistorischen Handwerkszeug und mit den Schlussfolgerungen nicht leicht macht. Sie zeugt von einer Wesensverwandtschaft eines Menschen, der zunächst die Goldschmiederei und erst dann die Kunstgeschichte gelernt hat und deshalb vielleicht besonders fasziniert von den Gegenständen Stoskopffs war. Bei seinem Lehrer, der ich wenigstens für eine gewisse Zeit sein durfte, stieß er beim Deuten ohnehin auf Skepsis; denn dass alle Malerei oder wenigstens alle Stillleben nur die Vergänglichkeit beschwören, das fand ich weder in den Quellen, noch in den Bildern. So ist denn ein Text entstanden, der sich vor Schnellschüssen hütet, der von einer bewundernswerten Klugheit ist und dem es gelingen möge, dass man dem Sonderling, dem alten Säufer Stoskopff Platz geben möge, damit seine schillernden und irritierenden Gemälde die Aufmerksamkeit erhalten, die ihnen gebührt. Eberhard König
PhiN-Beiheft 3/2006: 4
1 Einleitung
Jahrhundertelang gemäß akademischer Doktrin gering geschätzt, erfreut sich die Gattung Stilleben heute in der Kunstwelt wie auf dem Kunstmarkt großer Beliebtheit. Zahlreiche Ausstellungen und Publikationen beleuchten die große künstlerische Bandbreite dieser dekorativen Gemälde, ohne sich jedoch ihrer Interpretation in gleicher Weise eingehend und offen anzunehmen. "Ritual invocations of vanitas sometimes constitute the sole critical act", so urteilt Norman Bryson über den gegenwärtigen durchschnittlichen Stillebenkatalog (Bryson 1990: 8). Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts geriet auch die frühe deutsche Stillebenmalerei durch große Ausstellungen massiv ins Blickfeld der Kunstöffentlichkeit. Die Frankfurter Retrospektive zu Georg Flegel (1566–1638) von 1993/94 und die große Ausstellung des Schaffens von Sebastian Stoskopff (1597–1657) in Straßburg und Aachen anläßlich seines 400. Geburtstages dürfen als herausragende Belege dieser Entwicklung gelten. Mit einer 1996 erschienenen Werkmonographie (Hahn-Woernle 1996) und dem Katalog der Ausstellung in Straßburg und Aachen (Kat. Straßburg 1997) liegen zwei umfassende Untersuchungen von Stoskopffs Werk vor, die die Basis für jede Beschäftigung mit diesem Maler bilden. Im Gegensatz zu archivalischer Forschung, Katalogisierung seiner Werke und deren Vergleich mit zeitgenößischen Stilleben werden künstlerische Aspekte in Stoskopffs thematisch eingeschränktem Œuvre auch in diesen Publikationen nicht hinreichend berücksichtigt: Der Untersuchung von formalen Kriterien wie Komposition, Farbgebung und Lichtführung, der materiellen Beschaffenheit der dargestellten Gegenstände sowie deren optischen Qualitäten wurde bislang zu wenig Beachtung geschenkt, obwohl gerade in ihnen die Blicksensation Stoskopffscher Stilleben ihren Ursprung hat.
PhiN-Beiheft 3/2006: 5 Zentrales Kapitel der vorliegenden Arbeit ist deshalb eine ausführliche Werkbetrachtung. Stoskopffs Werk wird im Folgenden nach thematischen und kompositionellen Kriterien in neun Gruppen eingeteilt. Diese werden jeweils anhand eines eingehend beschriebenen Beispiels auf das Spezifische an Thema oder Komposition hin untersucht, um so der Eigenheit Stoskopffscher Stillebenmalerei näher zu kommen. Dabei steht das Interesse des Künstlers am ästhetischen Spiel mit dem Dargestellten, dessen Materialität und Form sowie Verhältnis zu Licht und Farbe im Vordergrund. Der stereotypen Interpretation von Stoskopffs Stilleben als Vanitas und moralisierende Allegorie wird in einem weiteren Hauptkapitel seine meisterhafte Darstellung optischer Phänomene entgegengestellt, die für seine Zeitgenossen von übergeordneter Bedeutung waren. Von Sebastian Stoskopff sind nahezu ausschließlich Stilleben bekannt, ihnen galt offenbar sein ungeteiltes künstlerisches Augenmerk. Es ist daher keine übertriebene Erwartung, in seinem Werk nach der Essenz jahrelanger künstlerischer Auseinandersetzung mit der Gattung Stilleben zu suchen. Dieser Suche sollen mit dem vorliegenden Artikel einige Beobachtungen hinzugefügt werden.
2 Sebastian Stoskopff im Licht der kunsthistorischen ForschungBis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein wurde die Stillebenmalerei für gering erachtet und in ihren unterschiedlichen Ausprägungen weitgehend vergessen. Maßgeblich die von Charles Sterling konzipierten Pariser Ausstellungen Les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle 1934 im Musée de l´Orangerie und La Nature Morte de l´antiquité à nos jours 1952 in der Orangerie des Tuileries sowie sein aus letzterer Ausstellung entstandenes Stilleben-Buch (Sterling 1959) legten dann erst die Fundamente für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Bereits im Frühjahr des Jahres 1934, wenige Monate vor der ersten Pariser Ausstellung, waren in der Amsterdamer Ausstellung De helsche en de Fluweelen Brueghel zwei Stilleben von Sebastian Stoskopff zu sehen, die aufgrund der falsch gelesenen Signatur aber dem unbekannten Meister A. Kopff zugeschrieben wurden. Nichtsdestotrotz charakterisiert der kurze Abschnitt von Pieter de Boer im zugehörigen Ausstellungskatalog den Stil der beiden Tafeln treffend: Ihre eigenartige, fast geheimnisvolle Stimmung mache sie der Arbeit nur weniger Künstler vergleichbar, so daß sich das künstlerische Umfeld des ihm unbekannten Malers nicht erschließe (de Boer 1934: 63). Nachdem jedoch noch während der Ausstellung die Signatur als diejenige Stoskopffs erkannt worden war, kauften die Straßburger Museen eines der beiden Gemälde an, das von Charles Sterling zusammen mit einem weiteren Straßburger Stilleben von Stoskopff noch im selben Jahr in der Pariser Ausstellung mit der richtigen Zuschreibung gezeigt werden konnte (Kat. Paris 1934: 147–149).
PhiN-Beiheft 3/2006: 6 Obwohl Sebastian Stoskopff zu seiner Zeit ein überaus geschätzter Meister war und seine Werke im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert in zahlreichen namhaften Sammlungen vertreten waren, darunter auch in den kaiserlichen Gemäldegalerien in Wien und Prag sowie im Cabinet du Roi des französischen Sonnenkönigs und im Palais Cardinal Richelieus (vgl. Hahn-Woernle 1996: 39 ff.; Kat. Straßburg 1997: 224–226), fiel er für mehr als zweihundert Jahre nahezu vollkommenem Vergessen anheim. Bis in das 20. Jahrhundert war eine Passage in Joachim Sandrarts Teutscher Academie, seinem 1675 in Nürnberg erschienenen Traktat mit Künstlerviten, die einzige bekannte Nachricht über das Leben des Sebastian Stoskopff. Die Wiederentdeckung des Malers ging von seiner Heimatstadt Straßburg aus, wo der Ankauf zweier Gemälde im Jahr 1931 den Anlaß gab, sich näher mit dem Maler zu befassen (Haug und Riff 1932: 7–8). Abbé Joseph Brauner, leitender Archivar und Bibliothekar der Stadt Straßburg, publizierte umfangreiche archivalische Recherchen zu Stoskopff, zeichnete erstmals ein plastisches Bild seiner Person und stellte neben den durch Sammlungsinventare schriftlich bezeugten Arbeiten vier erhaltene Werke des Malers vor (Brauner 1933: 27–40 und Anm. 142a). Seinem bekannten Œuvre konnten relativ rasch weitere signierte Werke zugeführt werden, da aufgrund der eigenwilligen Signatur – StosKopff – Bilder von ihm häufig mit falscher Zuschreibung ausgestellt oder publiziert wurden. So führt beispielsweise das Künstlerlexikon von Bénézit noch in der Neuauflage von 1999 zwei Stilleben aus den Musées du Havre unter dem Namen Hoskopff, während andere seiner Bilder in derselben Ausgabe unter Stoskopff verzeichnet sind (Bénézit 1999: VII, 191 und XIII, 285). Hans Haug, vor und nach der deutschen Besatzung Straßburgs im Zweiten Weltkrieg Direktor der Straßburger Museen, machte sich Stoskopffs Werk zu seinem Hauptanliegen. 1948 veröffentlichte er seine Erkenntnisse in einem umfangreichen Aufsatz, der in einen biographischen und einen künstlerischen Teil gegliedert ist und in einem Œuvre-Verzeichnis bis dahin bekannte sowie in Inventaren schriftlich bezeugte Werke von Stoskopff auflistet (Haug 1948: 23–72). In den folgenden Jahren erschienen zahlreiche Artikel von Haug zu wiederentdeckten Werken, die er 1961 noch einmal zusammenfassend darstellte (Haug 1952: 137–150; Haug 1959: 283–292; Haug 1961: 22–35; Haug 1965: 75–82). Für Hans Haug war Sebastian Stoskopff in erster Linie elsässischer Künstler, der die verschiedenen Einflüsse seiner Wanderschaft zu einer eigenständigen Ausprägung von Stilleben legiert und in seiner Straßburger Zeit zum Höhepunkt seines Schaffens gebracht hatte. In den Sujets seiner Bilder traditionell, sei es der vergeistigte Charakter seiner Stilleben, den außer ihm kein anderer Spezialist dieser Gattung vor Jean Baptiste Siméon Chardin (1699–1779) erreicht und der die am unteren Ende akademischer Hierarchie angesiedelte Stillebenmalerei aufgewertet habe. Aus diesen Gründen sieht Hans Haug Stoskopff in der Tradition der großen oberrheinischen Künstler seit dem Mittelalter (vgl. Haug 1948: 58–59; vgl. auch Dupeux 1997: 22–27).
PhiN-Beiheft 3/2006: 7 Charles Sterling konstatiert, daß im Werk des vielschichtigen und einflußreichen Künstlers Stoskopff keine kontinuierliche Entwicklung auszumachen ist; dabei sei Stoskopff derjenige der frühen Pariser Stillebenmaler gewesen, der die engsten Verbindungen zur niederländischen Malerei hatte sowie die Möglichkeit, deren künstlerische Innovationen mit seinem Repertoire zu verbinden (Sterling 1959: 74). Während Sterling ihn als am französischen Geschmack geschulten deutschen Künstler faustischen Wesens charakterisierte (Sterling 1959: 46)1, beschäftigte sich Michel Faré vor allem mit Stoskopffs Pariser Zeit (Faré 1962: I, 89–90, 101–111, 127; Faré 1974: 115–134), untersuchte seine Beziehungen zu französischen Stillebenmalern und ordnete sein Werk in die französische Malerei der Zeit ein.2 Die Untersuchungen von Gerhard Bott zu den Stillebenmalern in Daniel Soreaus Hanauer Werkstatt (Bott 1962: 27–93; Bott 1993: 234–240; Bott 1997: 60–75; Bott 2001: passim) und von Wolfgang J. Müller zum Flegel-Umkreis in Frankfurt (Müller 1956) brachten grundsätzliche Erkenntnisse zu Stoskopffs Ausbildung und künstlerischem Umfeld in Hessen. Anläßlich der Frankfurter Flegel-Ausstellung 1993/94 wurden die Beziehungen unter den Stillebenmalern der Mainregion im frühen 17. Jahrhundert erneut diskutiert. In ihrem Beitrag zeigt Michèle-Caroline Heck anhand einiger Bild-Vergleiche, daß der Einfluß Flegelscher Kompositionen auf Stoskopff genau bestimmt werden kann (Heck 1993: 241–246). Der kleine Katalog der Idsteiner Stoskopff-Ausstellung von 1987 rückte die Sammlertätigkeit des Grafen Johannes von Nassau-Idstein und dessen Auftraggeberschaft für Stoskopff ins Blickfeld (Berger 1987: 34–63; vgl. auch Müller 1987: 10–33). Diese Gesichtspunkte stehen auch im Mittelpunkt der Artikel von Christel Lentz, die diesbezüglich neue Aspekte herausarbeiten und die ersten eigenhändigen Schriftstücke von Stoskopff publizieren konnte (Lentz 1994a: 163–172; Lentz 1994b: 3–11). Christopher Wrights Annäherung an Sebastian Stoskopff wirkt schematisch; komprimierte Einschätzungen des Malers wie "Stoskopff´s art is unique. [...] being a totally isolated painter working in a style verging on the naïve" greifen in ihrer Überzeichnung zu kurz (Wright 1985: 94). Ähnlich verhält es sich mit seiner künstlerischen Einordnung der Stoskopffschen Stilleben, die Wright schlicht als gemalte Alltagserfahrung betrachtet. Die umfassendste Publikation zu Sebastian Stoskopff stellt die Monographie von Birgit Hahn-Woernle dar, die in einführenden Kapiteln zu Leben und Werk die Stoskopff-Forschung zusammenfaßt, in Teilen vervollständigt und um einen eigenen Interpretationsansatz ergänzt. Im akribisch zusammengestellten Werkverzeichnis führt Hahn-Woernle mehrere bislang unpublizierte Zuschreibungen an Stoskopff auf und vergrößert sein erhaltenes Œuvre auf 69 Bilder (Hahn-Woernle 1996: 103–271). PhiN-Beiheft 3/2006: 8 Ein Katalog ausgeschiedener Werke nennt 34 weitere Stilleben, die Stoskopff im Laufe der Zeit zugeschrieben, seinem Œuvre von Birgit Hahn-Woernle jedoch wieder genommen wurden; schließlich stellt die Autorin vier Stilleben als mögliche Arbeiten von Stoskopff zur Diskussion (Hahn-Woernle 1996: 273–289). Die 1997 in Straßburg und Aachen gezeigte Stoskopff-Retrospektive wartete ebenfalls mit einigen neuen Zu- und Abschreibungen auf. Der von Michèle-Caroline Heck verfaßte Katalog der ausgestellten Werke (Kat. Straßburg 1997: 131–207) stellte vermehrt auch künstlerische Kriterien in den Mittelpunkt. Ein dem Katalog vorangehender Textteil beschäftigt sich in zehn Aufsätzen verschiedener Autoren mit unterschiedlichen Aspekten aus Leben und Schaffen des Malers (vgl. vor allem Heck 1997: 28–59; Thuillier 1997: 16–21; Böhmer 1997: 94–107; Citroen 1997: 108–117; Mette 1997: 126–129).
3 Zum Leben und künstlerischen Umfeld des Malers
PhiN-Beiheft 3/2006: 9 Neben den Informationen aus Joachim Sandrarts Teutscher Academie basiert die Forschung zu Stoskopffs Leben weitgehend auf der Arbeit von Joseph Brauner, der mit seinem Quellenstudium wesentliche Elemente der Biographie zugänglich gemacht hat. Sebastian wurde als drittes Kind der Eltern Martha und Georg Stoskopff geboren und am 31. Juli 1597 in der Straßburger Kirche Alt-St. Peter getauft (Brauner 1933: 11 und 42). Es muß ein weltoffenes Elternhaus gewesen sein, da der Vater seit 1590 als Einspänniger, das heißt als berittener Kundschafter und Kurier, im diplomatischen Dienst der Freien Reichsstadt Straßburg stand und in vielen Missionen sowohl für den Magistrat als auch für Privatpersonen in ganz Europa unterwegs war (Brauner 1933: 9–10; vgl. zuletzt Heck 1997: 28–29). Im Dezember 1614 wandte sich der Vater mit der Bitte an den Rat der Stadt Straßburg, seinen begabten Sohn Sebastian, dessen Kunstfertigkeit er mit der Vorlage graphischer Arbeiten unterstrich, zum Maler und Baumeister ausbilden zu lassen, da dies nicht in seinem Vermögen stehe (Brauner 1933: 11 und 42). Sandrart schließt daraus fälschlicherweise, Sebastian Stoskopffs Vater sei Maler gewesen. Da Georg Stoskopff jedoch nur wenige Monate nach seiner Eingabe an den Magistrat unter Hinterlassung eines beträchtlichen Schuldenberges starb (Brauner 1933: 10), muß das Wort Vermögen in diesem Zusammenhang auf die finanzielle Situation bezogen werden. Im Dezember 1615 verzeichnen die Ratsprotokolle, daß sich Sebastian seit Juni des Jahres bei dem Wallonen Daniel Soreau in Hanau aufhalte und dort nach einer erfolgreichen Probezeit fünf Jahre lang in Malerei, Architektur und anderen Künsten unterwiesen werden solle.3 Die hierfür fälligen 100 Reichstaler übernahm die Stadt Straßburg, vermutlich in der Hoffnung, anschließend einen fähigen Baumeister in ihren Diensten zu wissen (Brauner 1933: 11, 15, 42–43). Die damaligen Beziehungen zwischen den Städten Straßburg und Hanau waren vielfältig, und Daniel Soreau war offenbar auch in Straßburg ein bekannter und geschätzter Mann.4 Daß Soreau ein guter Maler gewesen sei, betont Sandrart ebenso wie dessen Verdienste um Bau und Planung der Neustadt Hanau:
Trotz überlieferter Vielseitigkeit5 dürfte der Stillebenmalerei in Soreaus Werkstatt ein gewichtiger Anteil zugekommen sein; so nennt das Nachlaßinventar der Witwe Susanna Soreau 1621 mehrheitlich Früchte-, Blumen- sowie Tierbilder (vgl. zuletzt Bott 2001: 28–29; vgl. auch Bott 1962: 31–32), und die Werke seiner Schüler zeigen überwiegend Stilleben. Die Region am Main war mit den Hanauer Malern sowie Georg Flegel und seinem Umkreis in Frankfurt somit ein wichtiges Zentrum früher Stillebenmalerei und mutmaßlich ein bedeutender Markt für Bilder derlei Sujets. PhiN-Beiheft 3/2006: 10 Bis heute ist es nicht überzeugend gelungen, bestimmte Werke von Stoskopff in die Hanauer Periode zu datieren (vgl. zuletzt Heck 1997: 30–33; Bott 1997: 68 und 72). Auch die Werke der anderen Schüler von Soreau, darunter dessen Söhne Jan, Isaak und Peter, werden deutlich später datiert, und für den Lehrmeister selbst kann kein einziges Bild als gesichert gelten.6 Die ergiebigsten Rückschlüsse auf die Arbeitsweise der Werkstatt lassen sich aus den Stilleben von Peter Binoit ziehen, der dort zu Stoskopffs Lehrzeiten wohl als Geselle tätig war und dessen signierte Werke aus den Jahren 1611–27 stammen (vgl. zuletzt Bott 2001: 46–84 und 196–212; Bott 1997: 66–70; Heck 1997: 30–31). Von dem ebenfalls bei Daniel Soreau tätigen Frans Godin, besser bekannt unter der italianisierten Version seines Namens, Francesco Codino, sind datierte Werke aus den Jahren 1621–24 erhalten (vgl. Bott 2001: 59–61, 78–82 und 213–222; Bott 1993: 235 ff.; Bottari 1964: 107–114). Stoskopffs fünfjährige Ausbildung bei Daniel Soreau endete vorzeitig, da der greise Meister im März 1619 verstarb. Wie Sandrart zu berichten wußte, leitete Stoskopff fortan die Werkstatt, beendete angefangene Werke und kümmerte sich um die Ausbildung der Lehrlinge, unter denen sich auch der junge Sandrart selbst befand (Sandrart 1675: I, 310). Es ist davon auszugehen, daß Stoskopff mindestens bis Dezember des Jahres 1620 in Soreaus Werkstatt arbeitete, so lange der mit der Stadt Straßburg geschlossene Ausbildungsvertrag lief; möglicherweise führte Stoskopff die Werkstatt sogar bis zum Tod der Witwe Soreau im September 1621 (vgl. Heck 1997: 30). Offenbar wollte er sich anschließend in der Mainregion niederlassen, denn im Jahr 1622 ersuchte er die Stadt Frankfurt um Aufnahme als Beisasse, einem Status unterhalb der Bürgerrechte. Doch das Gesuch wurde abschlägig beschieden (vgl. Hahn-Woernle 1996: 15 und 35), so daß Stoskopff nach Frankreich weiterzog. Sandrart faßte die nächsten beiden Lebensjahrzehnte von Stoskopff in einem Satz zusammen: Er reiste durch Frankreich nach Paris, unternahm von dort aus eine Italienreise, auf der er 1629 in Venedig mit Sandrart zusammentraf, und ging schließlich von Paris aus wieder in seine Heimatstadt Straßburg zurück. Indirekt bestätigt werden Sandrarts Informationen durch Besitzinventare Pariser Bürger, in denen Werke von Stoskopff sehr zahlreich verzeichnet sind (vgl. Hahn-Woernle 1996: 38–40; Kat. Straßburg 1997: 224–227). Ansonsten ist über seine Pariser Zeit nur wenig bekannt, vor allem zur ersten Phase zwischen 1622 und 1629 existieren keinerlei Dokumente. Es ist davon auszugehen, daß sich der Maler im Pariser Quartier St. Germain-des-Prés niedergelassen hat, wo zu dieser Zeit die meisten Zugereisten lebten. Wie Michèle-Caroline Heck belegen konnte, wohnte Stoskopff jedoch zumindest zeitweilig im Marais.7
PhiN-Beiheft 3/2006: 11 In dem Gebiet rund um die Kirche St. Germain, die damals noch außerhalb der Stadtmauern – auf der Wiese – lag, entstand zu Beginn des 17. Jahrhunderts wegen der strikten Haltung der innerstädtischen Zünfte eine Künstlerkolonie, in der sich viele Maler von auswärts aufhielten, so auch in großer Zahl Religionsflüchtlinge aus Flandern. Hier dürfte die frühe französische Stillebenmalerei entscheidende Anregungen aus den Niederlanden erfahren haben. Motivische und stilistische Ähnlichkeiten der Bilder geben Aufschluß über Beziehungen unter den Pariser Stillebenmalern der Zeit: Neben den aus Antwerpen stammenden Malern Pieter van Boucle und Jean-Michel Picart kann Stoskopff vor allem mit Franzosen wie Jacques Linard sowie den deutlich jüngeren Lubin Baugin und Louise Moillon in Austausch gestanden haben (vgl. v. a. Haug 1948: 30–32 und 46–47; Faré 1974: 120–124; Hahn-Woernle 1996: 51 und 65 ff.; Heck 1997: 35–40). Auf seiner Italienreise dürfte Stoskopff neben Venedig auch andere wichtige italienische Städte – der Grand Tour, wie Haug vermutet (Haug 1965: 76) – besucht haben, für einen Stillebenmaler ein sehr ungewöhnliches Unterfangen (vgl. Heck 1997: 34). Auf diesem Wege könnte er mit der Malerei der Caravaggio-Nachfolge in Kontakt gekommen sein, deren Einfluß in Stoskopffs Bildern sich in Farbgebung und Personendarstellung bemerkbar macht (vgl. v. a. Haug 1952: 140–142). Aufgrund der Beeinflussung durch niederländische Stillebenmalerei wird für Stoskopff auch eine Reise in die Niederlande in Betracht gezogen (zuletzt Schwarz 1987: 38), für die es jedoch keine weiteren Anhaltspunkte gibt, da Einflüsse der niederländischen Kunst ebenso durch sein Umfeld in Hanau und in Paris erklärt werden können. Zweifelsfrei nachweisen konnte Michèle-Caroline Heck dagegen Stoskopffs Aufenthalt in Troyes (Heck 1997: 34–35). Quelle ist die 1633 veröffentlichte Véritable Narré de ce qui s'est passé en la conversion de Me Jean Rochette, le plus Ancien advocat de Troyes, die unter anderem von dem gescheiterten Versuch berichtet, Sebastian Stoskopff zum Katholizismus zu bekehren. Demnach hatte sich der Maler 1633 in Diensten des Baron Guichard du Vouldy in dessen Schloß bei Troyes befunden; möglicherweise war Stoskopff an der Ausstattung des Landschlosses beteiligt. In Anbetracht der Tatsache, daß ein 1650 erstelltes Nachlaßinventar der Sammlung des Jean-Baptiste de Bretagne 22 Werke von Stoskopff aufführt, hält Hahn-Woernle auch einen längeren Aufenthalt des Malers in Lothringen für denkbar, wo Jean-Baptiste als commissaire des guerres und Kunsthändler tätig war (Hahn-Woernle 1996: 16 und 38–39). Sein Status in Paris als Fremder ohne Niederlassungsrecht dürfte für Stoskopff auf Dauer problematisch gewesen sein, weshalb er sich wiederholt an Fürstenhöfe verdingt hat. Möglicherweise liegt hier auch der Grund für den Ortswechsel nach Straßburg.8
PhiN-Beiheft 3/2006: 12 Offensichtlich wollte er seine Arbeit dort auf eine andere Basis stellen , denn am 11. Februar des Jahres 1641 trat er der Straßburger Zunft der Goldschmiede, Kunsthandwerker und Maler Zur Steltz bei (Brauner 1933: 21 und 44), weshalb die Rückkehr in seine Geburtsstadt für das Jahr 1640 angenommen wird. Es entspann sich ein Streit darüber, ob der Neuankömmling der Zunft ein Meisterstück abzuliefern habe. Die protokollierten Auseinandersetzungen ziehen sich bis zu einem Kompromiß weit ins Jahr 1642 hinein: Statt der Anfertigung eines Meisterstückes schenkte Stoskopff dem Rat der Fünfzehner zum Ausgleich ein Bild für die städtische Ratsstube, welches am 13. Oktober 1642 präsentiert werden konnte. Dabei hatte sich Stoskopff weitgehend durchgesetzt, denn die Zunft wurde ob ihres Verhaltens mit einem Verweis belegt, während der Maler für sein "über die massen schones kunstgemähl" aus der städtischen Münze entlohnt wurde (Brauner 1933: 21–22 und 44–46). Aus einer Beschreibung von 1713 geht hervor, daß es sich bei dem im Zuge der französischen Revolution im Hôtel de Ville verbrannten Gemälde um ein Küchenstück handelte, offenbar ein so repräsentatives Werk, daß es auch als Stilleben vollkommen selbstverständlich im städtischen Ratssaal aufgehängt wurde:
Die Streitigkeiten mit Zunft und Zünftigen, die in dem Neuankömmling nicht zu Unrecht einen Konkurrenten fürchteten, waren offenbar endgültig beigelegt, denn im Jahr 1647 wurde Sebastian Stoskopff sogar zum Beisitzer des Ehrsamen Gerichts der Zunft Zur Steltz gewählt (Brauner 1933: 22 und 44). Im Rahmen seiner Zunftmitgliedschaft wie im familiären Bereich war Stoskopff von Goldschmieden umgeben: Seine Schwester Martha hatte 1635 Nicolas Riedinger, einen der besten Straßburger Goldschmiede geheiratet, und Stoskopff selbst stärkte diese verwandtschaftliche Beziehung, indem er 1646 Anna Maria, die Tochter Riedingers aus erster Ehe, heiratete. Ein Jahr später wurde dem Paar die Tochter Anna Maria geboren, deren drei Taufpaten alle aus Goldschmiede-Familien stammten (vgl. Brauner 1933: 23, 41–42, 46). Auf Stoskopffs Malerei scheint sich diese Umgebung inspirierend ausgewirkt zu haben: Gold- und Silberwaren erscheinen fortan häufig in seinen Bildern, und einige davon lassen sich den Goldschmieden seines Umfeldes zuordnen (vgl. Brauner 1933: 23; Haug 1961: 32; Haug 1978: Introduction; Citroen 1997). In Straßburg traf Stoskopff auf intellektuell und künstlerisch gebildete Kreise; Auftraggeber und Sammler seiner Gemälde fanden sich ebenso im Straßburger Bürgertum wie unter deutschen Fürsten. PhiN-Beiheft 3/2006: 13 Anfang der 1640er Jahre wird Stoskopff Graf Johannes von Nassau und Idstein kennengelernt haben, der im Zuge des Dreißigjährigen Krieges all seine Gebiete verloren und in Straßburg Schutz und Exil gefunden hatte. Nachdem er vom Kaiser wieder in seine Rechte eingesetzt worden war, kehrte der Landesfürst im Dezember 1646 in seine Residenz nach Idstein zurück. Neben dem Wiederaufbau seines vom Krieg verwüsteten Landes widmete sich der kunstsinnige Graf der Anlage eines Schloßgartens sowie dem Aufbau einer Kunstkammer und Gemäldesammlung.9 Dafür tätigte er Ankäufe auf dem Kunstmarkt und beauftragte Künstler direkt, so auch Sebastian Stoskopff, zu dem Graf Johannes eine enge Beziehung hatte (vgl. Berger 1987: 43–45; Lentz 1994a: 163–172; Lentz 1994b: 3–11). Daß der Graf viele Bilder von Stoskopff besessen habe10, berichtet bereits Sandrart. Schon in Straßburg hatte Graf Johannes bei Stoskopff Bilder in Auftrag gegeben; davon zeugt ein Brief, den ein Straßburger Mittelsmann am 21. Mai 1647 an den Grafen nach Idstein schrieb und in dem sich eine Beschreibung zweier Bildnisse findet, die Stoskopff vom Grafen und dessen zweiter Ehefrau vor deren Rückkehr in ihre Residenz angefertigt hatte.11 Von Stoskopffs Wertschätzung durch Johannes von Nassau-Idstein kündet vor allem die Sandrartsche Episode von dem Geschenk zweier Bilder im Jahre 1651 an den Habsburger Kaiser Ferdinand III.; daß der Graf Werke von Stoskopffs Hand auswählte, bezeugt sowohl seine hohe Meinung von diesem Künstler als auch den repräsentativen Charakter von dessen Bildern. Für das Jahr 1652 ist ein weiterer Auftrag des Grafen an Stoskopff belegt (vgl. Lentz 1994a: 167; Lentz 1994b: 7). So verwundert es nicht, daß dieser auch vor Ort in Idstein für Johannes tätig war. Bis 1994 war der Aufenthalt in Idstein ausschließlich durch Nachricht von seinem dortigen Tod und eine Notiz in einem Straßburger Sammlungsinventar belegt.12 Drei eigenhändige Schriftstücke von Stoskopff – die einzigen eigenhändigen Notizen des Malers überhaupt – belegen nun seine Anwesenheit in Idstein zwischen April 1656 und Januar 1657.13 In den Straßburger Ratsakten taucht der Name Sebastian Stoskopff letztmalig im März 1655 auf: Er hatte der städtischen Kasse Kapital geliehen, dessen Zinsen traditionell in Naturalien ausbezahlt wurden. Da für die Jahre 1650 bis 1655 die regelmäßige Auszahlung von Wein an Stoskopff vermerkt ist (vgl. Brauner 1933: 23–24), wird seine Abreise in den Taunus im Zeitraum zwischen April 1655 und März 1656 liegen; Christel Lentz verweist diesbezüglich auf eine Reisegesellschaft aus Straßburg, die im Februar 1656 nach Idstein gekommen war (Lentz 1994b: 8). Stoskopff wurde in Idstein nicht zum Hofmaler berufen und wohnte im Gegensatz zu einigen anderen Künstlern im Dienste des Grafen auch nicht an dessen Idsteiner Hof. Darauf verweisen Gerüchte, die nach Stoskopffs Tod in Idstein kursierten und von der angeblichen Ermordung des Malers durch den Wirt seiner Herberge Zum Löwen handelten. PhiN-Beiheft 3/2006: 14 Das Idsteiner Kirchenbuch vermerkt unter dem Datum des 11. Februar 1657 Stoskopffs Beerdigung "zu ungewöhnlicher Zeitt ohne gesang und klang", da er "sich an Brandewein zu tod gesoffen".14 Daß der Wirt des Löwen, Balthasar Moyses, an dem unwürdigen Ableben des Malers einen "hochprozentigen" Anteil gehabt haben kann, mag die Gerüchte angeheizt haben.15 Der Wirt scheint deshalb auch verhört worden zu sein, ohne daß sich daraus eine aktenkundige Klärung des Falles ergeben hätte. Erst knapp zwanzig Jahre später zeitigte Stoskopffs Tod in Idstein ein makabres Nachspiel, dem im Rahmen eines Hexenprozesses auch der Wirt Balthasar Moyses zum Opfer fiel. Eine der Hexerei angeklagte Witwe beschuldigte den Wirt des Satanskultes und sagte aus, daß er für den Mord an Stoskopff vom Teufel gelobt worden sei. Die Inquisition bestrafte Moyses daher mit der Höchststrafe: Verbrennen bei lebendigem Leibe (vgl. Brauner 1933: 25–26; Berger 1987: 60–61; Hahn-Woernle 1996: 21–22 und 37).
4 Die Stilleben von Sebastian Stoskopff: Eine Werkbetrachtung in neun AbschnittenDas kritische Werkverzeichnis von Hahn-Woernle katalogisiert 69 erhaltene Werke von Stoskopff, Heck spricht von "etwa 60 Bildern" (vgl. Hahn-Woernle 1996: 8; Heck 1997: 28). Hinzu kommen weitere Zuschreibungen vor allem aus dem Kunsthandel, die teilweise sehr fragwürdig erscheinen. Den vorliegenden Ausführungen liegen der Straßburger Katalog von Heck und das Werkverzeichnis von Hahn-Woernle zugrunde. Dabei wird keine Untersuchung der zwischen Hahn-Woernle und Heck strittigen Zuschreibungen angestrebt, sondern eine Werkbetrachtung, die Charakter und Eigenart von Stoskopffs Œuvre verdeutlichen will und dabei auf unstrittig für Stoskopff gesicherten Bildern basiert. Von den derzeit bekannten Gemälden sind zehn durch Inschriften sicher datiert. Eine Reihe von Werken trägt die sich immer gleichende Signatur StosKopff, sie gelten als vom Maler eigenhändig signiert; Hahn-Woernle zählt davon 29 Werke, während Heck nur 26 nennt.16 Die zeitliche Einordnung der undatierten Werke stellt ein Problem der Stoskopff-Forschung dar, weil der Maler immer wieder auf eigene Kompositionsschemata und Bildideen zurückgriff. Eine lineare Entwicklung seines Œuvres ist dadurch nur schwer nachvollziehbar und die Datierung der Bilder oft spekulativen Charakters. In der folgenden Darstellung wird deshalb auf eine chronologische Ordnung von Stoskopffs Werk verzichtet; stattdessen werden in neun Abschnitten kompositionelle und thematische Gruppen gebildet, die jeweils anhand einer exemplarischen Arbeit eingehend betrachtet werden.
PhiN-Beiheft 3/2006: 15 Diese Werkgruppen haben keinen ausschließlichen Charakter; die Werke können den Kriterien auch mehrerer Gruppen entsprechen. Für bestimmte Werkgruppen ergeben sich aufgrund inschriftlich datierter Gemälde zeitliche Anhaltspunkte. Alle von Stoskopff signierten Werke zeigen Stilleben. Darüber hinaus muß er auch als Porträtmaler tätig gewesen sein: ein Brief vom 21. Mai 1647 belegt die Anfertigung eines Doppelporträts des Grafen Johannes von Nassau-Idstein und seiner Frau Anna. Durch eine Beschreibung der Bildnisse17 vermittelt dieser Brief einen Eindruck seiner Porträtkunst, ebenso ein Stich nach dem verlorenen Original von Stoskopff.18 Ein Porträt vom Maler Stoskopff wird auch im Nachlaßinventar des Grafen von Idstein aufgeführt.19 Da bislang kein Bildnis von Stoskopffs Hand ausfindig gemacht werden konnte, bleibt seine Handschrift als Porträtmaler jedoch ungewiß. Stoskopffs hauptsächliches Interesse galt unzweifelhaft der Stillebenmalerei.
Monumentalisierte Objekte des täglichen Lebens Am häufigsten finden sich in Stoskopffs Werk bildfüllende Darstellungen eines Alltagsgegen- standes, oft aus dem Bereich Küche bzw. Nahrungsmittel. Um ein besonders eindrucksvolles Exemplar handelt es sich bei der Erdbeerschale in Straßburg (Abb. 1) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 1, 132; Hahn-Woernle 1996: Nr. 4, 110): Auf einer schmalen durchlaufenden Holzplatte steht eine weiße Schale mit blauer Bemalung, vermutlich chinesisches Porzellan der Wan Li-Periode oder sogenanntes Kraak-Porzellan. Die Schale ist mit großen grünen Blättern ausgelegt, die über den Rand hinausragen und auf denen sich ein hoher, gleichmäßig geschichteter Berg roter und weißer Erdbeeren mit kurz abgeschnittenen Stielen häuft. Das Bild wird von einem dunklen, bräunlich-olivfarbenen Fond undefinierbar hinterfangen. Das Licht fällt direkt von links auf die Schale, so daß diese einen Schlagschatten wirft und die linke Hälfte der Erdbeeren mehr im Licht, die rechte mehr im Schatten liegt. Die weißen, unreifen Erdbeeren befinden sich zum größten Teil auf der helleren Seite und dienen Stoskopff zur farblichen Strukturierung des Früchteberges, während auf der dunklen, undifferenzierteren Seite rote Früchte überwiegen. Auf der Oberfläche der Erdbeeren entstehen kleine, sehr helle Lichtreflexe, die den Früchten Glanz verleihen. PhiN-Beiheft 3/2006: 16 Die Erdbeerschale nimmt den gesamten Bildraum ein und wirkt dadurch ausgesprochen monumental. Dabei ist sie ganz leicht aus der Mitte nach links verschoben, eine kleine Asymmetrie, die dem Bild eine belebende Wirkung verleiht und das ohnehin größere Gewicht der hellen linken Seite ausgleicht. Die Verschiebung aus der Mittelachse wird von Stoskopff auch dadurch ausponderiert, daß er auf der rechten Seite eines der großen, den Schalenrand überlappenden Blätter so positioniert, daß der Abstand des Blattes zum rechten Bildrand genau dem Abstand der Schale zum linken Bildrand entspricht. Es handelt sich also bei aller Simplizität des Motivs um ein stringent durchkomponiertes und ausgewogenes Bild, dessen klare Farbgebung – leuchtendes Rot der Erdbeeren, leicht gebrochenes Blau der Porzellanbemalung und dunkelgrünes Laub – vor dunklem Hintergrund zu seiner Monumentalität beiträgt. Vor allem zu Beginn seines Schaffens dürfte Stoskopff die Darstellung von Früchteschalen bevorzugt haben, die ein beliebtes Motiv der frühen Stillebenmalerei waren und in großer Zahl auch in der Hanauer Werkstatt entstanden sind (vgl. die Abb. 2 und Abb. 3).20 Stoskopffs Bilder mit der Darstellung von Alltagsobjekten sind von kleinem Format – meist zwischen 20 x 30 und 50 x 60 cm. Von undefinierbarem Dunkel hinterfangen, entsteht Räumlichkeit allein durch den dargestellten Gegenstand, der monumental den Bildraum ausfüllt. Farbpalette und Beleuchtung sind warm und gedämpft, gelegentlich haben die einzelnen Objekte kräftigere Lokalfarbigkeit. Die dargestellten Gegenstände sind jedoch nicht nur in formaler Hinsicht bildfüllend, sondern auch in inhaltlicher, da Stoskopff die volle Aufmerksamkeit des Betrachters auf ein Objekt lenkt. Da es sich meist um keine wertvollen oder exotischen Dinge handelt, liegt der Reiz dieser Bilder in ihrer optischen Präsenz. Es zeugt vom Selbstbewußtsein eines Malers, sich ganz auf seine künstlerische Fähigkeit zu verlassen, dem Dargestellten solche Unmittelbarkeit zu verleihen, daß es über den realen Wert erhoben wirkt. Unterschiedlichste Gegenstände kommen in ähnlicher Bildanlage vor: ein hölzerner Zuber und ein Rechaud (Abb. 5, 6 und 7), Lebensmittel (Abb. 8 und 9) sowie Muscheln, eine Spanschachtel und ein Römer (Abb. 10, 36 und 40). Drei inschriftlich auf das Jahr 1644 datierte Gemälde belegen, daß sich Stoskopff dieses Bildschemas auch in seinem späteren Werk bedient hat (Abb. 11, 33 und 34).
Gelegentlich verwendet er diese Kompositionsform auch zur Darstellung mehrerer, gleichrangig nebeneinander stehender Gegenstände. Um eine solche Arbeit handelt es sich bei den Pendants in Le Havre (Abb. 12 und 13) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 25 und 26, 176–177; Hahn-Woernle 1996: Nr. 63 und 64, 254–257). Die zwei Bilder zeigen auf nahezu quadratischer Leinwand einen gedeckten Tisch. Ohne Überschneidungen bietet Stoskopff vor schwarzem Hintergrund verschiedene Gegenstände dar, die teilweise auf Zinntellern, teilweise auf der für Stoskopff typischen bildparallelen Holzplatte liegen. PhiN-Beiheft 3/2006: 17
Das eine Bild (Abb. 12) zeigt am linken vorderen Rand des Tisches einen glänzenden Zinnteller, auf dem ein roter Flußkrebs liegt; rechts daneben befindet sich eine Zitrone. In der hinteren Bildhälfte sind drei Zinnteller übereinander gestapelt: einer bedeckt umgekehrt den untersten, so daß uns verborgen bleibt, welche Speise dort warmgehalten wird; ein kleinerer zuoberst enthält eine bräunlich-rote Sauce. Am linken Bildrand steht ein mit Weißwein gefülltes venezianisches Glas. Ein ähnliches Glas mit entsprechendem venezianischen Zierrat und einer etwas schlankeren, höheren Kuppa, die ebenfalls mit Weißwein gefüllt ist, findet sich auf der rechten Seite des anderen Bildes wieder (Abb. 13). Dort liegt am linken vorderen Bildrand, leicht über die Kante des Holzes ragend, ein kleines Brot; direkt daneben, nur durch einen haarfeinen Zwischenraum vom Brot getrennt, steht ein Zinnteller mit einem reifen Apfel und rundherum drapierten Walnüssen. Hinten auf dem Tisch befindet sich ein größerer Zinnteller mit einem Stück Käse. In Komposition, Farbe und Form sind beide Bilder spiegelbildlich aufeinander bezogen: Größe und Platz der Zinnteller entsprechen sich in beiden Bildern ebenso wie die Weingläser; Zitrone und Brötchen, Krebs und Apfel sowie Käse und Sauce stehen in farblicher Beziehung zueinander. Korrespondenzen gibt es auch innerhalb der Bilder selbst. Der sich im Zinnteller perfekt spiegelnde Krebs greift das Mittel der Spiegelung auf, und zwischen den Gegenständen eines jeden Bildes bestehen formale wie farbliche Diagonalbezüge. In diesen Kompositionen schöpft Stoskopff den Bildraum vollständig aus, ohne daß die dargestellten Gegenstände bedrängt wirken oder ihre solitäre Wirkung verlieren. PhiN-Beiheft 3/2006: 18 Die dargestellten Gegenstände dienen Stoskopff in erster Linie als Vorwand für das optische Spiel mit Licht und seinen Reflexen, welches die Präsenz beider Gemälde genauso bedingt wie die spannungsvolle Relation zwischen den einzelnen Gegenständen. Stoskopff verleiht den Gegenständen solcher Bilder durch Beleuchtung und Glanz sowie Auswahl und Zusammenstellung21 eine Würde, die sie in ihrer ästhetischen Opulenz über ihren materiellen Wert erhebt. Das einzelne Objekt erhält durch seine isolierte Anordnung monumentalen Charakter; die Gegenstände nehmen ohne nennenswerte Überschneidungen auratisch ihren Platz im Gemälde ein (vgl. auch die Abb. 14, 15, 16, 17 und 18). In diesen Bildern ist Stoskopff am ehesten der frühen spanischen Stillebenmalerei eines Sánchez Cotán oder eines Zurbarán vergleichbar.
Bilder mit Büchern und Graphiken Das erste datierte Gemälde von 1625 (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 2, 134; Hahn-Woernle 1996: Nr. 8, 118–120; Haug 1948: Nr. 1, 60) könnte ebenso der Werkgruppe der monumentalisierten Objekte wie den Bildern mit Büchern und Graphiken zugerechnet werden, die in Stoskopffs Werk zahlreich vertreten sind. Das Bild zeigt auf einer durchlaufenden bildparallelen Holzplatte drei Bücher und eine Kerze vor schwarzem Fond (Abb. 19).
Die weiße, schon weit niedergebrannte Kerze, die am vorderen linken Rand mit Wachs auf dem Holz des Tisches festgeklebt wurde, ist gerade erloschen; ein dünner Rauchfaden steigt vom Docht auf. Das Zentrum des Bildes nehmen drei gänzlich verschiedene Bücher ein: Auf der Tischplatte liegt ein sehr dickes Exemplar mit Goldschnitt, das in einen weichen hellen Ledereinband eingeschlagen wurde, der mit verknoteten Lederriemen verschlossen ist. Im Hintergrund steht ein großes Buch in dunkelbraunem Leder horizontal auf dem vorderen Buchschnitt, was zur Aufbewahrung von Büchern unüblich, für ein Bücherarrangement aber von darstellerischem Wert ist, weil sich das Buch so aus einem ungewohnten Blickwinkel zeigt. An das dunkelbraune Exemplar angelehnt steht auf dem dicken Buch ein aufgeschlagener längsformatiger Band mit der Darstellung eines Bauern aus den radierten Capricci von Jacques Callot (1617/21) auf dem rechten Blatt (zu den Capricci von Callot vgl. Böhmer 1997: 94–96; Lieure 1924: IV, Nr. 214–263 [1re série] und Nr. 428–477 [2e série], hier Capriccio Nr. 239/453). PhiN-Beiheft 3/2006: 19 Die durchscheinende Kontur einer Druckplatte auf der unbedruckten linken Seite läßt erkennen, daß auf deren Vorderseite ebenfalls ein Stich zu denken ist. Stilleben mit Kerze und Büchern rufen Vanitas-Interpretationen auf den Plan, die jedoch in diesem Falle durch die unprätentiöse Anordnung der Gegenstände und die Konzentration auf das geöffnete Buch konterkariert werden. Dabei wölbt sich dessen linke Seite dem Betrachter plastisch entgegen und scheint in ihrer realistischen Darstellung viel mehr zum Umblättern einzuladen, als die Vergänglichkeit des Seins vor Augen zu führen. Für Sebastian Stoskopff werden Bücher zu einem prägenden Bildelement, deren Darstellung ihn wie die gemalte Abbildung von Stichen22 immer wieder erneut beschäftigte (Abb. 20, 21, 22, 26, 38 und 39). Dabei sind es vor allem Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Büchern, die Stoskopff zur Auseinandersetzung mit diesem Thema und zu Variationen in Größe, Form, Farbe, Einband sowie ihrer Stellung und Lage im Bild animiert zu haben scheinen. Ein jüngst entdecktes Bücherstilleben mit graphischen Darstellungen, von Stoskopff signiert und 1644 datiert (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 30, 184–185), belegt das fortdauernde Interesse des Malers an diesem Thema.
Repräsentative Formate: Das räumlich gestaffelte Küchenstück Auf einem durchlaufenden hölzernen Bord liegt in der linken vorderen Ecke eine Orange mit grünem Blattwerk (Abb. 23). Rechts daneben, etwas zurückgesetzt, steht eine große runde Metallschale, die mit Wasser gefüllt ist. Sie ist teilweise von einem diagonal in die Bildtiefe ausgerichteten Brett bedeckt, auf dem ein sehr großer Karpfen liegt. Am rechten vorderen Bildrand steht ein Holzzuber, von drei Reifen aus Weidenruten zusammengehalten und ebenfalls mit Wasser gefüllt. Zwischen Schale und Zuber sind zwei violette Schalotten mit grünen Stielansätzen drapiert. Im Hintergrund der linken Bildhälfte baut sich ein hölzerner Kasten auf, dessen rechte Kante in einer rasanten perspektivischen Verkürzung nach links hinten verläuft. Auf dieser Kastentruhe befinden sich ein zur Hälfte mit Rotwein gefülltes venezianisches Glas, ein großer runder Brotlaib und ein Messer, dessen Klinge vom Brot verdeckt wird. Die Truhe ist von einer dunklen Ziegelmauer hinterfangen, die auf der rechten Seite bündig mit dem Möbel abschließt. Der restliche Bildhintergrund ist undefinierbar dunkel und könnte einen weiter in die Tiefe gehenden Raum andeuten. PhiN-Beiheft 3/2006: 20 Hinter dem Zuber positioniert Stoskopff eine weitere rechteckige Kastentruhe, etwas höher als die linke, so daß die darauf stehende beige-schwarz glasierte tönerne Grape bis fast an den oberen Bildrand reicht. Die Elemente des Bildes sind somit auf verschiedenen Ebenen in die Höhe wie in die Tiefe gestaffelt. In der Farbgebung des Bildes herrschen tonige Erdfarben vor, von denen sich die rötlichen Gegenstände abheben: der tiefrote Wein, die rötliche Orange sowie die violetten Schalotten. Akzente setzt Stoskopff auch in der Lichtführung, die einige Gegenstände wie mit einem Spotlight aus dem Dunkel des Raumes heraushebt. Die Bildmitte bleibt dagegen leer und dunkel. Wie aus drei kleineren Stilleben zusammengesetzt, präsentiert jede Ebene ein eigenes Arrangement: Links oben Brot, Messer und Weinglas, wie sie Stoskopff zusammen mit einer Korbflasche auch in einem anderen Stilleben darstellt (Abb. 8); rechts oben ein Stilleben mit Grape, die der Maler mit verschiedenen Gemüsesorten ebenfalls an anderer Stelle aufgreift (Abb. 9); unten ein Stilleben mit Karpfen und Holzzuber, die beide von Stoskopff häufig dargestellt wurden.
Eine räumliche Erschließung des Bildes wie in dem beschriebenen Exemplar in Lyon (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 9, 148–149; Hahn-Woernle 1996: Nr. 15, 136–137) nimmt Stoskopff häufiger vor. Die datierten Küchenstücke von 1626 und 1640 (Abb. 24 und 25) sowie die Große Vanitas von 1641 (Abb. 26) geben zudem zeitliche Anhaltspunkte, die darauf verweisen, daß sich Stoskopff dieser Kompositionsform zu verschiedenen Zeiten bediente. Da alle diese Gemälde große Formate aufweisen, läßt sich vermuten, daß er dieses Kompositionsschema zur Gliederung großer repräsentativer Bilder entwickelte, während er bei kleineren Formaten eine schlichtere Anordnung der Gegenstände bevorzugte.
PhiN-Beiheft 3/2006: 21 Ebenfalls räumlich gegliedert sind zwei großformatige Bilder, in die Stoskopff die Darstellung von Personen einschloß, so daß diese Stilleben Züge von Genrebildern enthalten.23 Das eine Gemälde zeigt hinter einer langen Anrichte eine im Profil gegebene junge Frau, die damit beschäftigt ist, gerupftes Geflügel auf einen Bratspieß zu schieben (Abb. 27). Auf der durchlaufenden bildparallelen Anrichte befinden sich verschiedene Nahrungsmittel: links eine Zitrone und eine Korbflasche, in einem daneben stehenden Flechtkorb zwei Salatköpfe, zwei Bund Spargel, Artischocken und Rettiche, davor zwei große Fische. Fast mittig ist ein großer flacher Holzzuber zu sehen, links daneben liegt ein Messer und direkt davor eine Pfeffertüte. Am rechten Bildrand steht ein Kupferkessel, links davon liegt ein toter Truthahn und davor eine Keule über einem Mangold. Etwas erhöht befindet sich links hinten eine weitere Ablage mit einem Kessel, der von einem Teller mit gespicktem Geflügel bedeckt ist und vor dem zwei Kalbsfüße liegen. An der dahinterliegenden, fast schwarzen Wand, die räumlich unklar bleibt, hängen ein Bund Zwiebeln und ein toter Vogel. Rechts neben der Frau begrenzt ein vertikaler, braun gebeizter Balken, in dessen Fuge eine eben erloschene Kerze steckt, den dunklen Küchenraum hinter ihr. Das rechte Bilddrittel gibt oberhalb der Anrichte den Blick auf eine weitere Szene frei: In einem sehr hohen Raum sitzt eine junge Frau vor einem offenen Kamin, in dem ein kleines Feuer brennt. Im Hintergrund sieht man an der Wand unter einem hoch angesetzten Fenster einen Kerzenhalter, darunter ein Regal mit zwei Krügen und einer Waage sowie ganz unten einen gedeckten Tisch – ein Stilleben im Stilleben. Die ganze Szenerie ist in unwirklichen Grau-Blau-Tönen gehalten, während das Bodegón auf der linken Bildseite in dunklen, satten Farben erscheint. Zu dem beschriebenen Gemälde, in Straßburg Die vier Elemente oder Der Winter genannt (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 17, 164–166; Hahn-Woernle 1996: Nr. 40, 192–195; Haug 1959: 283–287), gibt es ein signiertes und inschriftlich auf 1633 datiertes Pendant, Die fünf Sinne oder Der Sommer (Abb. 28) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 16, 162–164; Hahn-Woernle 1996: Nr. 41, 196–199; Haug 1948: Nr. 2, 60–61), welches denselben Bildaufbau mit anderen Gegenständen zeigt: Die junge Frau in der Bildmitte, ebenfalls im Profil gegeben, blickt hier nach links in die entgegengesetzte Richtung; mit ihrem linken Arm hält sie vor der Brust einen großen Korb mit Früchten, aus dem sie mit der rechten Hand gerade einen Pfirsich nimmt. PhiN-Beiheft 3/2006: 22 Die hölzerne Anrichte ist hier durch einen etwas höheren Tisch ersetzt, der, mit einem prachtvollen Orientteppich bedeckt, nicht bis an den linken Bildrand durchgeführt ist. Auf dem Tisch befinden sich links eine silberne Vase mit Blumen und ein aufklappbares Schachspiel, auf dem ein Würfelbecher und drei Würfel liegen. Die rechte Tischhälfte nimmt eine Laute ein, deren Griffbrett ebenfalls auf dem Schachfeld aufliegt. Vor dem Instrument und über seinem Hals sind dekorativ zwei querformatige Notenhefte drapiert. An der linken Bildseite, hier etwas tiefer als der Tisch angesetzt, steht auf einem achteckigen Beistelltisch ein Himmelsglobus, über ihm an der Wand befindet sich eine Violine. In diesem Bild ist der Raum auf der linken Seite nicht verdunkelt, so daß am Ende des flachen Raumes eine Bretterwand erkennbar ist, an der eine Uhr und ein geöffnetes Schränkchen hängen. Der Ausblick auf der rechten Bildseite, hier in grünlichem Grau, zeigt eine riesige Terrasse, auf der sich eine Laute spielende Frau in Rückenansicht und ein Hund befinden. Hinter der Terrasse liegt ein von wolkigem Himmel überwölbter See, an dessen anderem Ufer eine Hügellandschaft mit Burg zu sehen ist. Bilder mit der Darstellung von Personen – neben den beiden beschriebenen Werken ist auf die Erwähnung entsprechender Motive in Inventaren sowie zwei umstrittene Zuschreibungen24 zu verweisen – nehmen in Stoskopffs Werk eine Sonderstellung ein und werden in der Forschung meist mit seiner Italienreise in Verbindung gebracht. Tatsächlich läßt die Darstellung der Personen den Einfluß der Caravaggio-Nachfolge vermuten, der allerdings ebenso gut von Malern wie Simon Vouet, der 1612 nach Italien gegangen und von Rom 1627 nach Paris zurückgekehrt war, in die französische Hauptstadt tradiert worden sein könnte. Auch die kräftigere Farbigkeit dieser Bilder verweist auf italienische Einflüsse. Stilleben mit Menschen waren jedoch bei den Pariser Malern keine Seltenheit, von denen Louise Moillon das früheste bekannte Exemplar geschaffen hat (vgl. zuletzt Heck 1997: 39). Anscheinend wollte Stoskopff mit den Sommer-Winter-Pendants Gemälde von besonders repräsentativem Charakter schaffen, wofür ihm die Darstellung von Personen angemessen schien. Den von ihm gemalten Menschen mangelt es jedoch an Belebtheit, so daß sie selbst zu einem Teil des Stillebens werden. Die beiden beschriebenen Stilleben enthalten in großformatiger Komposition viele der von Stoskopff bevorzugten Gegenstände und Bildelemente; für sein Schaffen nur teilweise charakteristisch, nehmen sie in seinem Werk aufgrund ihrer Größe und Opulenz dennoch einen zentralen Platz ein. PhiN-Beiheft 3/2006: 23 Neben den Verweisen auf Sommer und Winter wurden die beiden Bilder auch als Darstellungen der Fünf Sinne beziehungsweise der Vier Elemente interpretiert, klassische Themen der Stillebenmalerei, die Stoskopffs Werk ebenso inhärent sind wie Anspielungen auf das Motiv der Vanitas.
Der gedeckte Tisch. Eine Variation in vier Bildern Eine Reihe großformatiger Bilder eines gedeckten Tisches weist bei entsprechender Komposition zum Großteil identische Gegenstände auf:
Die Berliner Version (Abb. 29) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 34, 192–193; Hahn-Woernle 1996: Nr. 32, 174–175) zeigt einen schweren dunkelbraunen Holztisch, der mit einem strahlend weißen Tuch bedeckt ist. Dieses gibt den linken Rand des Tisches frei und ermöglicht so den Blick auf die vordere Ecke mit dem darunter liegenden voluminös-bauchigen Tischbein. Das feste gestärkte Tuch, das unachtsam über den Tisch geworfen scheint, zeigt akurate, scharfkantige Knicke, wie sie durch die Lagerung einer gefalteten Decke verursacht werden. Die Mitte des Bildes nimmt ein auf dem Tisch stehender rechteckiger Weidenkorb ein, der bis über den Rand mit Gläsern gefüllt ist. Rechts neben dem Korb befindet sich eine hohe, bauchige Tonflasche, die eine rot-braun gewirkte Kordel zum Transport als Pilgerflasche kenntlich macht. Sie ist oliv-braun glasiert und mit floralen Motiven bemalt.
PhiN-Beiheft 3/2006: 24 Schräg dahinter steht eine etwas kleinere gläserne Pilgerflasche mit Korbmantel und direkt hinter dem Gläserkorb – kaum mehr sichtbar vor dem durchgängig schwarz gehaltenen Hintergrund – eine Vierkantflasche aus Glas. Auf der linken Bildseite zeigt Stoskopff auf dem unbedeckten Teil des Holztisches eine kleine Fayenceschale im Vordergrund sowie eine über Eck gestellte Vierkantflasche aus Zinn dahinter. Die fünf Gegenstände sind halbkreisförmig um den Gläserkorb angeordnet und bilden von der Schale links bis zur Pilgerflasche rechts eine nach oben ansteigende Linie. Die Komposition folgt einem ausgefeilten Spiel von Gegensätzen und Entsprechungen in Form und Farbe: So wie Stoskopff den voluminösen Körper der tönernen Pilgerflasche umgekehrt in der Form des Tischbeines wieder aufnimmt, entspricht die scharfkantige Darstellung der Zinnflasche den Falten der Tischdecke, finden die hellen Lichtreflexe auf Zinn ihre umgekehrte Entsprechung im Schattenspiel auf der weißen Decke. Von dieser Motivvariation sind vier Bilder erhalten, drei mit kleineren Unterschieden in der Auswahl der Gegenstände, das vierte deutlicher variiert:25 Wie das Berliner Bild zeigt die Version in Burnley (Abb. 30) (vgl. Kat. Straßburg 1997: 192–193; Hahn-Woernle 1996: Nr. 31, 170–172) eine weiße Tischdecke, hier allerdings ein Tuch in getöntem Weiß, das in weichen großzügigen Falten ohne Knicke vom Tisch herabfällt. An die Stelle der viereckigen Zinnflasche ist den weich gerundeten Formen und der beigetonigen Farbe der Decke entsprechend eine zylindrische Teedose mit dezentem chinesischen Blumendekor getreten.
In einem dritten Exemplar (Abb. 31) (vgl. Kat. Straßburg 1997: 192–193; Hahn-Woernle 1996: Nr. 33, 176–177) verzichtet der Maler auf den Raum ober- und unterhalb des Tisches und beschränkt die Darstellung der querformatigen Tafel auf das Stilleben: Hier steht der Gläserkorb schräg auf dem Tisch, die Fayenceschale befindet sich mit einer viereckigen Teekanne auf einem Zinnteller, und die gläserne Vierkantflasche im Hintergrund ist durch einen Henkelkrug ersetzt. Der Tisch wird zudem von einem orientalischen Teppich bedeckt, über den, wie in den beiden vorigen Bildern über den Holztisch, von rechts eine weiße Tischdecke gezogen ist. PhiN-Beiheft 3/2006: 25 Auch in Version vier (Abb. 32) (vgl. Kat. Straßburg 1997: 192–193; Hahn-Woernle 1996: Nr. 34, 178–179) bedeckt ein prachtvoller Teppich den Tisch, über den rechts eine feine weiße Überdecke mit dekorativen dunklen Streifen gelegt wurde. Die Objekte dieses Bildes unterscheiden sich dagegen weitergehend von denen der übrigen Fassungen. Zwar hat Stoskopff auch hier einen schräg gestellten Gläserkorb und eine Pilgerflasche dargestellt, die übrigen Gegenstände sind jedoch wertvoller und verleihen der querformatigen Tafel eine prunkvollere Wirkung, zu der auch das leuchtende Rot des Teppichs beiträgt. Für Stoskopff scheint in dieser Bildvariation das Spiel mit Kontrasten und Entsprechungen, mit Form und Farbe sowie mit Wiederholung und Veränderung interessant gewesen zu sein, durch das Auswahl und Arrangement der Gegenstände wesentlich bedingt sind. Dabei gewinnt er den Materialien wie Metall und Glas, für deren Darstellung er aufgrund seiner perfekten Abbildung der Lichtreflexe berühmt war (vgl. u. a. Haug 1965: 80; Sterling 1959: 46), durch kleine Veränderungen der Komposition, des Lichts, der Farbe oder der Gegenstände immer neue Seiten ab.
Gläserkörbe und Goldschmiedekunst als zentrale Bildelemente In der beschriebenen Bildvariation als Element einer größeren Komposition eingesetzt, ist der Gläserkorb als zentrales Motiv auch eigenständiges Thema in Stoskopffs Schaffen. Zwei signierte und 1644 datierte Exemplare geben einen zeitlichen Anhaltspunkt; das eine Bild befindet sich in Straßburg (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 31, 186–187; Hahn-Woernle 1996: Nr. 57, 240–241; Haug 1948: Nr. 12, 65), das andere in kanadischem Privatbesitz (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 32, 188–189; Hahn-Woernle 1996: Nr. 58, 242–243; Haug 1948: Nr. 13, 65) und wird im folgenden beschrieben (Abb. 33). Auf einer hölzernen bildparallelen Tischplatte, deren linke hintere Ecke zu sehen ist, während der Bildrand die vordere links beschneidet, steht vor schwarzem Hintergrund ein runder geflochtener Weidenkorb; darin befindet sich ein fein säuberlich arrangiertes Durcheinander von sieben Gläsern venezianischer Art und drei goldenen Pokalen – außen zwei einander gleichende Buckelpokale und in der Mitte ein Ananas- oder Traubenpokal.
PhiN-Beiheft 3/2006: 26 Vor dem Korb sind drei Gegenstände symmetrisch auf der Holzplatte verteilt: links ein gesprungener Gläserkelch ohne Stiel, in der Mitte ein silberner Ratsbecher mit Schlangenhaut-Dekor und vergoldetem Rand sowie rechts ein zur Hälfte gefüllter kleiner Römer. Die Straßburger Fassung des Motivs (Abb. 34) unterscheidet sich von der kanadischen Version vornehmlich in der Wahl des Bildausschnitts. Während der kanadische Gläserkorb von den Bildrändern knapp begrenzt wird, vergrößert Stoskopff in der Straßburger Fassung den Ausschnitt der Darstellung unter Beibehaltung der Größe des Gemäldes; dadurch gewinnt das Motiv deutlich an Tiefe und Raum, büßt jedoch einen Teil seiner unmittelbaren Präsenz ein. Das Straßburger Bild zeigt einen entsprechenden Korb mit sechs Gläsern – fünf nach venezianischer Art und eine Trinkschale – sowie drei Goldpokalen mit glatter ornamentierter Oberfläche. Auf der Tischplatte vor dem Weidenkorb befinden sich auch hier drei symmetrisch verteilte Gegenstände: links ein Bruchstück eines venezianischen Glases, in der Mitte ein winziges Stück eines Noppenglases und rechts der Deckel eines Goldpokales (Citroen 1997: 113 erkennt darin eine goldene Tischglocke), bekrönt von der kleinen Skulptur eines Putto. Das überfüllte Chaos des Gläserkorbes bietet Stoskopff ein ideales Feld für gemalte Lichtreflexe und -brechungen. Jedes Glas und jeder goldene Pokal befindet sich in einer anderen Lage und steht damit in einem anderen Winkel zum Licht. Der Glanz der Pokale läßt die Gläser teilweise golden schimmern, die sich vom schwarzen Hintergrund sonst fast nur durch ihre Lichtreflexe abheben. In der fragilen Anordnung der Gefäße im akurat geflochtenen Korb zeigt sich Stoskopffs Fähigkeit ausgewogen spannungsvoller Kompositionen. Stoskopffs Gläserkörbe werden meist als Vergänglichkeitsallegorien interpretiert, die an die Flüchtigkeit irdischen Reichtums und die Fragilität menschlichen Lebens gemahnen sollen (vgl. Haug 1948: 65; Bott 1979: 444; Müller 1987: 26–28; Hahn-Woernle 1996: 204, 240, 242 und 250; Kat. Straßburg 1997: 186). Hauptargument ist neben dem Edelmetall der Pokale das gebrochene Glas. Glasscherben stehen jedoch auch für Lichtbrechung, da Licht gerade in zerbrochenem Glas starke Effekte erzeugt. So könnten dieser Wortanalogie entsprechend gläserne Bruchstücke darauf hinweisen, daß ein Bild das optische Phänomen der Lichtbrechung verhandelt.
PhiN-Beiheft 3/2006: 27 Dieses vornehmlich künstlerische Interesse muß nicht im Widerspruch zu der inhaltlichen Vanitas-Deutung stehen; vielmehr wäre Stoskopff eine Ambivalenz der Bildidee zuzutrauen, womit er sowohl ein auf dem Markt gängiges Motiv bedient als auch ein genuin künstlerisches Vorhaben verfolgt hätte.
Weitere Gemälde von Stoskopff zeigen einen Gläserkorb als zentrales Motiv (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 23, 173–174; Hahn-Woernle 1996: Nr. 43, 202–203, und Nr. 44, 204–206). Das von Sandrart erwähnte 'kaiserliche' Gemälde enthält einen Gläserkorb mit Pokalen, eingebunden in eine hochformatige Komposition mit kupfernem Spülbecken sowie weiteren Gefäßen aus Edelmetall (Abb. 35) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 33, 190–191; Hahn-Woernle 1996: Nr. 61, 248–250; Haug 1948: Nr. 14, 65–67). In seinem ursprünglichen Zustand war das Gemälde jedoch querformatig und maß Inventaren zufolge etwa 88 x 112 cm. Beschnitten wurde es im Verlauf des 18. Jahrhunderts, wohl um es dem anderen Stoskopff-Gemälde in kaiserlichem Besitz anzupassen, dessen Maße mit dem heutigen Format des Karlsruher Bildes identisch sind (vgl. Hahn-Woernle 1996: 248–250). Glänzendes Edelmetall und die Transparenz von Glas stehen im Gegensatz zu gewöhnlicheren Gegenständen anderer Werke von Stoskopff und verleihen diesen Stilleben auch materielle Opulenz. Dabei sind es besonders die unterschiedliche Materialität der Gegenstände und das entsprechende Spiel des Lichtes, die die Faszination dieser Motive ausmachen. Prunkvolleren Charakter gewinnen Stoskopffs Bilder vor allem mit seiner Rückkehr nach Straßburg. Die Darstellung von Goldschmiedekunst wird zu einem wichtigen Bestandteil seiner Bilder. Dabei verdeutlicht die Tatsache, daß in seinem Straßburger Umfeld viele Goldschmiede existierten, deren Werke sich mit Darstellungen von Goldschmiedekunst in Stoskopffs Stilleben identifizieren lassen (vgl. Brauner 1933: 23; Haug 1961: 32; Haug 1978: Introduction; Citroen 1997), also inspirierend auf ihn gewirkt haben, die Arbeitsweise des Stillebenmalers Stoskopff: Er komponiert seine Bilder als künstlerisches Arrangement malerischer Gegenstände aus seiner Lebenssphäre, die er nach der Natur malt und ihnen durch das Spiel mit Licht, Farbe und Komposition optisch-ästhetische Reize abgewinnt.
PhiN-Beiheft 3/2006: 28 Bilder mit Muscheln Zu den Darstellungen von opulenter Materialität und Beleuchtung gehören auch Stoskopffs Stilleben mit Muscheln, wie das signierte und 1643 datierte Bild in Straßburg (Abb. 36) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 38, 198; Hahn-Woernle 1996: Nr. 24, 154–155): Eine königsblaue Decke, von einer aufwendigen Goldborte mit Fransen eingefaßt, ist so über einen dunkelbraunen Holztisch gezogen, daß dessen balusterförmiges rechtes Bein gerade noch sichtbar bleibt. Die Goldborte des Tischtuchs, das eigentlich für einen runden Tisch geschnitten ist, fällt in einem weichen Linksschwung vom Tisch herab, während das blaue Tuch ob der rechteckigen Form des Tisches Falten wirft. Links auf dem Tisch liegt eine leuchtend rote, stark verästelte Koralle; rechts daneben, wie von zwei Ästen der Koralle gehalten, ein goldfarben changierender Nautilus von enormer Größe. Der Bildhintergrund ist schwarz.
In der Farbgebung verfährt Stoskopff äußerst subtil. Während er der Fransenborte des Tuches einen metallisch goldenen Farbton gibt, geht das changierende Perlmutt des Nautilus stark ins Gelbliche, so daß sich die beiden Goldtöne nicht gegenseitig neutralisieren. In der massiven Präsenz der drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau, die Stoskopff direkt nebeneinander setzt, wird durch die Verwendung ihrer primären Mischfarben Verbindung geschaffen; so spiegelt sich die Koralle im Perlmutt des Nautilus in rötlich-orangenem Glanz, so wirft die Koralle auf das blaue Tuch einen violetten Schatten, und wo der Nautilus auf dem Tuch liegt, reflektiert er dessen Farbe in Grün. In Bildern wie diesem klingt die Idee der Kunst- und Kuriositätenkammern an, die sich zu Stoskopffs Zeit größter Beliebtheit erfreuten und die es auch in Straßburg zu besichtigen gab (vgl. vor allem Rott 1930: 1–46). PhiN-Beiheft 3/2006: 29 Diese Kabinette vereinigten unterschiedlichste Hervorbringungen von Natur und Mensch zum staunenden Ergötzen des Betrachters und auf der Suche nach Erkenntnis vom Zusammenspiel der Dinge, wie es makrokosmisch das Wunder der 'Gotteskunstkammer' Natur bewirkt. So weist Hanns-Ulrich Mette darauf hin (Mette 1997: 127–128), daß die Konstellation der beiden Elemente des oben beschriebenen Straßburger Bildes, die Stoskopff in eine konzentrierte, spannungsreiche Beziehung setzt, auch noch knapp hundert Jahre später faszinierend wirkte: Die bis dahin getrennt in der fürstlich-sächsischen Kunstkammer aufbewahrten Koralle und Nautilus wurden 1724 von Johann Heinrich Köhler in Form eines Nautiluspokals vereint (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Grünes Gewölbe, vgl. Abb. 37). Weitere Bilder dieses Charakters sind das Exemplar mit Athena-Statuette in Princeton (Abb. 38), dasjenige mit Juno-Statuette im Louvre (Abb. 39) sowie das New Yorker Bild einer Spanschachtel mit Nautilus und Pantherschnecke (Abb. 40).
Die Bildserie mit Karpfen und Spanschachtel Auf einer hölzernen bildparallelen Tischplatte liegt an der vorderen Kante eine große ovale Spanschachtel. Darauf steht eine flache schwere Tonschale, in der ein großer toter Karpfen liegt. Am rechten Bildrand steht im Hintergrund eine große, mit Beschlägen verzierte Kupferkanne mit Deckel, links hinten schiebt sich eine Mauer ins Bild, an der eine soeben erloschene Kerze befestigt ist. Der Fond ist schwarz. Bei dieser Darstellung handelt es sich um ein sehr beliebtes Bildmotiv; Hahn-Woernle verzeichnet in ihrem Werkkatalog sechs Gemälde des Themas von Stoskopffs Hand sowie eine Version eines anderen Malers (Hahn-Woernle 1996: Nr. 50–55, 223–236, und Nr. A 33, 287).26 Von den sechs Stoskopff zugeschriebenen Bildern sind zwei von ihm signiert, ein drittes trägt die Signatur PNichon, und die drei übrigen sind unbezeichnet. Ein Maler namens Pierre Nichon ist bekannt, so daß es sich bei dem Nichon-Gemälde um eine Kopie nach Stoskopff handeln dürfte (vgl. Laveissière 1982: 704). Daß Hahn-Woernle das Bild in Kenntnis dieser Umstände trotzdem für Stoskopff reklamiert (Hahn-Woernle 1996: 234–236), scheint im Einverständnis mit Peter A. Lipp erfolgt zu sein, der das Bild aufgrund "naturwissenschaftlicher Untersuchungen [...] untrennbar mit dem Werk Sebastian Stoskopffs verbunden" sieht, jedoch ohne dieses näher zu begründen (Lipp 1996: 99). Die Stoskopff-Ausstellung in Straßburg und Aachen zeigte die signierte Variante aus dem Museum in Clamecy sowie eine neu entdeckte, ebenfalls signierte Fassung, die im Dezember 1996 bei Sotheby's in London versteigert wurde und sich mittlerweile in New York befindet (Kat. Straßburg 1997: 209, Pl. 2). Es existieren also drei von Stoskopff signierte Versionen sowie mindestens fünf weitere Exemplare des Motivs. Sieben der Bilder zeigen rechts eine Kupferkanne, dem achten wurden an ihrer Statt auf der linken Seite eine ganze und eine halbe Orange beigegeben. PhiN-Beiheft 3/2006: 30 Die Gemälde unterscheiden sich aber auch in Details. Im folgenden sollen die drei von Stoskopff signierten Versionen miteinander verglichen werden, da sich in der Variation des Motivs das künstlerische Interesse des Malers besonders klar zeigt: In der Bildanlage nahezu identisch sind die beiden Bilder in Montbéliard (Abb. 41) (vgl. Heck 1997: 40–41; Hahn-Woernle 1996: Nr. 51, 226–227) und in New York (Abb. 42) (vgl. Kat. Straßburg 1997: 209, Pl. 2).
Die vordere linke Ecke des Holztisches wird vom Bildrand beschnitten; die Spanschachtel liegt mittig am Rand des Tisches und steht, genauso wie die Tonschale auf ihr, vorne leicht über. Stoskopff staffelt die Objekte also sowohl in die Höhe als auch dem Betrachter entgegen – eine fragile Konstruktion, die zum spannungsvollen Aufbau des Bildes beiträgt. Die beiden Gemälde unterscheiden sich jedoch in der stofflichen Behandlung der einzelnen Gegenstände. Das New Yorker Bild besticht durch seine Materialdarstellung; so sind auf der Kupferkanne Spuren ihrer Verarbeitung wie beispielsweise einzelne Hammerschläge und auf der von links ins Bild geschobenen Wand ihre gemauerte Struktur zu erkennen. In Montbéliard steht das Spiel des Lichts auf dem Material der Gegenstände im Vordergrund, die deutlich weniger stofflich erscheinen. Für das Bild in Clamecy (Abb. 43) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 14, 158–159; Hahn-Woernle 1996: Nr. 50, 224–225) wählte Stoskopff einen deutlich höheren Blickwinkel, so daß sogar die hintere Tischkante sichtbar ist. Die Spanschachtel ragt wie in den beiden anderen Versionen leicht über die vordere Kante des Tisches hinaus, während die Tonschale merklich zurückgeschoben ist. Das Motiv verliert damit an unmittelbarer Präsenz, zumal auch der Umraum größer bemessen ist. Links auf dem Tisch befinden sich die Orangen, so daß der Bildausschnitt im Vergleich zu den Varianten mit Kupferkanne nach links verschoben ist.
PhiN-Beiheft 3/2006: 31 Die Orangen ähneln der Kupferkanne in Farbe und rundlicher Form, haben jedoch eine völlig andere Oberflächen-Textur. Aspekte wie dieser scheinen bei der Kompositionsänderung wesentlich gewesen zu sein. Wie bereits bei anderen Bildvariationen zu beobachten war, spielt Stoskopff ein Motiv häufig unter verschiedenen Gesichtspunkten durch, mit kleinen Änderungen in der Auswahl der abgebildeten Gegenstände, der Komposition, der Beleuchtung und der Oberflächenbehandlung des Dargestellten. Das künstlerische Interesse am Motiv zielt offenbar darauf ab, das dargestellte Objekt in seinen verschiedenen Facetten zu beleuchten und zu erfassen.
Als Objekt seiner Stilleben hat Stoskopff Stiche und Graphiken regelmäßig in seine Bilder einbezogen. Die Isolierung der Blätter als zentralen und einzigen Bildgegenstand mit Trompe-l´œil-Charakter dürfte eine Neuerung des späteren Schaffens sein. Das von Sandrart gerühmte 'kaiserliche' Gemälde mit der Darstellung des Triumphes der Galatea ist erhalten und befindet sich heute in Wien (Abb. 44) (vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 42, 204–205; Hahn-Woernle 1996: Nr. 62, 251–252; Haug 1948: Nr. 15, 65–67). Auf einer Staffelei aus sehr dunklem Holz, die vor dem dunklen Hintergrund nur schwer auszumachen ist, wurde mittels zwölf roter Siegellack-Punkte ein Blatt befestigt, das eine radierte Darstellung der Meeresgöttin Galatea zeigt. Die Ecken des leicht hochformatigen Blattes sind nicht fixiert, so daß sie für den Betrachter durch Krümmungen und Knicke in bester Trompe-l´œil-Manier greifbar geworden sind. Den nahezu quadratischen Abdruck der Druckplatten-Ränder auf dem weichen, weißen Papier zeigt Stoskopff deutlich; der rechteckigen Druckplatte ist die oval radierte Darstellung einer Meeresszene eingefügt. PhiN-Beiheft 3/2006: 32
Auf zwei von links ins Bild schwimmenden Meeresungeheuern sitzt die Göttin Galatea, umgeben von zwei Putten und zwei Tritonen, wovon einer die Fanfare bläst, während der andere Galatea an den spärlich bekleideten Körper greift. Die Idee zu dieser dynamischen Darstellung stammt nicht von Stoskopff; die Vorlage bildet ein 1644 von Michel Dorigny gefertigter Stich des Motivs nach einem Gemälde von Simon Vouet. Stoskopff verzichtet in seiner Wiedergabe allerdings auf die Darstellung fliegender Amoretten oberhalb der Gruppe. Das Stoskopff-Bild muß zwischen 1644 und 1651 entstanden sein, da die Übergabe des Bildes an Kaiser Ferdinand III. im Jahre 1651 durch Sandrart und die Provenienz belegt ist (vgl. Sandrart 1675: I, 310; Hahn-Woernle 1996: 40–41 [Auszüge aus den Inventaren der kaiserlichen Gemäldesammlungen in Prag und Wien]). Um die Qualität der Stoskopffschen Arbeit hervorzuheben, schmückt Sandrart seinen Bericht mit dem antiken Topos der 'Augentäuschung' aus, wie er die Kunstliteratur prägt. Arnold Houbraken berichtet in seiner Schouburgh von 1718–21 die gleiche Episode über seinen Lehrer Samuel van Hoogstraten, der demnach im selben Jahr 1651 dem Habsburger Kaiser Ferdinand III. ein Trompe-l´œil übergeben haben und damit den gleichen Täuschungs-Erfolg beim Kaiser erzielt haben soll (Houbraken 1719: II, 124; vgl. auch Böhmer 1997: 102–105). Christa Burda betonte in ihrer Dissertation über Trompe-l´œils, daß Stoskopffs Wiener Gemälde zusammen mit dem nicht mehr erhaltenen 'bedriegertje' von Hoogstraten am Anfang der Entwicklung von Trompe-l´œil-Malerei stehe, deren erstes dokumentarisch belegbares Exemplar Stoskopffs Bild darstelle (Burda 1969: 6–7 und 25; vgl. zuletzt auch Ebert-Schifferer 2002: 26; Tummers 2002: Nr. 34, 187). Die Tradition der 'Augenbetrüger' reicht in die Antike zurück und wurde als Teil größerer Bildkompositionen vor allem seit der Renaissance wieder aufgegriffen, so daß Burdas zeitlicher Festlegung etwas Willkürliches anhaftet. Zweifelsohne zeigt sich in Stoskopffs Trompe-l´œils jedoch die Fähigkeit, künstlerische Einflüße aufzunehmen und in der persönlichen Ausprägung zur Entwicklung eines Bildtypus beizutragen, der sich vor allem in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts großer Beliebtheit erfreute. Ein weiteres Stoskopff-Exemplar dieser Art wurde vor einigen Jahren in Privatbesitz ausfindig gemacht (Faré und Chevé 1996: 123–124, 128; vgl. auch Heck 1997: 47): ein Stich von Callot, wie im Wiener Bild mittels roter Siegellackpunkte an einer Staffelei befestigt. Nicht mehr zu lokalisieren ist ein signiertes und 1646 datiertes Trompe-l´œil mit einer gemalten Federzeichnung von Stoskopff, das sich bis 1859 in der Gemäldegalerie Dresden befand.27 Die immer wieder diskutierte Frage, ob sich Sebastian Stoskopff auch als Kupferstecher betätigt habe28, hat nicht zuletzt durch seine Vorliebe für gemalte Stiche Nahrung erhalten. PhiN-Beiheft 3/2006: 33 Von daher liegt es nahe, in der vom jüngeren Matthäus Merian bezeugten Stoßkopfischen Manier des Kupferstucks29 genau diese Art des in Öl gemalten Stichs zu sehen, da es hierfür bildliche und schriftliche Belege gibt, jedoch keine Graphiken, Vorzeichnungen und Radierungen von Stoskopff bekannt sind. In den Trompe-l´œils zeigt sich Stoskopffs Spiel mit der Realitätsnachahmung paradigmatisch. Angesichts des deutlich sichtbaren Pinselstrichs scheint eine Täuschung des Betrachters nur schwer vorstellbar und deshalb wohl kaum beabsichtigt gewesen zu sein. Vielmehr übertrifft der Maler die perfekte Imitation der Natur oder der Kunst mit seiner speziellen Sichtweise des dargestellten Gegenstandes, die das Objekt für das Auge des Betrachters künstlerisch aufwertet und – gerade durch die nicht vorhandene letzte Perfektion – aus seinem alltäglichen Kontext herauslöst. Dabei verschiebt sich der künstlerische Schwerpunkt von der täuschenden Nachahmung des Stiches mit den Mitteln der Malerei hin zur Ästhetisierung des Bildes, bei der die als Farbakzent eingesetzten roten Siegellackpunkte von größerer Bedeutung sind als die perfekte Darstellung des Stiches.
Stoskopffs Kompositionen sind sehr schlicht. Die kleineren Bilder – zwischen 20 x 30 cm und 50 x 60 cm – zeigen wenige Objekte, oft sogar nur eines, das Stoskopff durch einen eng begrenzten Bildausschnitt und einen relativ flachen Blickwinkel dem Betrachter monumental vor Augen stellt. Diese Bildanlage scheint Stoskopff zu allen Zeiten und mit den verschiedensten Objekten angewendet zu haben. In größeren Bildformaten – bis etwa 70 x 80 cm – gibt Stoskopff mehreren Gegenständen Platz und gewährt den dargestellten Objekten mehr Raum, wodurch der einzelne Gegenstand weniger monumental wirkt, die Dinge untereinander jedoch in ein spannungsvolles Verhältnis gerückt werden. Für große und repräsentative Kompositionen – das größte Bild mißt 116 x 188 cm – ist die Erschließung der Bildhöhe und -tiefe kennzeichnend.
Dem Licht kommt in Stoskopffs Bildern hohe Bedeutung zu. Es fällt ausnahmslos von links ein und taucht das Stilleben in einen warmen Goldschimmer. Stoskopff geht dabei nicht stereotyp vor und verzichtet auf eine stringente Lichtführung; er setzt Licht intentional ein, spielt mit Hell-Dunkel-Kontrasten und setzt Akzente; bestimmte Objekte werden entweder mit einem Spotlight fokussiert oder milde in indirektes Licht getaucht, wobei das Spiel mit Lichtreflexen auf unterschiedlichen Materialien eine zentrale Rolle innehat. Der Lichtinszenierung unterwirft Stoskopff auch die Farbgebung. Leuchtende, klare Farben sind sehr selten, eine verhalten monochrome Farbpalette herrscht vor: tonig-warme Erdfarben vor immer sehr dunklem, oft schwarz gehaltenem Fond.
PhiN-Beiheft 3/2006: 34
Farbakzente setzt Stoskopff vor allem in Rot, häufig auch durch Gelb oder Gold in Form stark lokalfarbiger Gegenstände. Grün taucht als reine Farbe seltener auf, Blau nur in zwei Fällen (vgl. die Abb. 36 und 38).
Hinsichtlich des Bildaufbaus gilt Stoskopffs hauptsächliches Interesse – wie an den Bildbeispielen in Berlin und Burnley oder den Pendants in Le Havre gezeigt – farblichen Korrespondenzen und Symmetrien, Hell-Dunkel-Kontrasten sowie dem Spiel mit der Form dargestellter Objekte, die er entweder als Kontrast oder als Äquivalent auffaßt. Diese Gesichtspunkte müssen als ein wesentliches Kriterium für die Auswahl der dargestellten Gegenstände angesehen werden.
Obwohl die Stoskopffschen Stilleben von detailgenauer Darstellung und feiner Ausarbeitung geprägt scheinen, ist der Farbauftrag teilweise sehr großzügig. Das im fertigen Bild häufig noch sichtbare Leinwandkorn verleiht den Gemälden eine belebte Oberflächenstruktur, die den Eindruck einer zügigen Pinselführung verstärkt. Die meisten Werke zeigen keinen durchgängigen Grad der Ausarbeitung, sondern unterschiedliche Schwerpunkte.
Über manche Gegenstände scheint Stoskopff mit schnellem, fast grobem Malgestus hinweg gehuscht zu sein, so daß bei näherer Betrachtung beispielsweise die Zitrone des Bildes in Le Havre als eine unscharfe Anhäufung von farbigen Punkten erscheint (vgl. die Abb. 12a);29a andere Objekte dagegen versteht er geradezu feinmalerisch nachzuahmen, bis hin zu Gebrauchs- oder Verarbeitungsspuren an den Gegenständen. Auf diesem Spiel mit der realistischen Abbildung liegt Stoskopffs Hauptaugenmerk: Daß die Darstellungen zum Beispiel von Gläsern oder Pokalen oft wenig exakt sind, fällt erst bei genauerem Hinsehen auf, da der Gesamteindruck der Bilder stimmig ist und von Unschärfen oder Verzerrungen nicht beeinträchtigt wird. Dabei entspricht diese Vorgehensweise des Malers unseren Sehgewohnheiten; das menschliche Auge sieht nie ein gleichmäßig scharfes Gesamtbild, sondern fokussiert immer bestimmte Bereiche. In diesem Sinne nötigt Stoskopff den Betrachter seiner Bilder zu einer spezifischen Sichtweise. Dabei spaltet er Änderungen des Blickes in Form von Bildvariationen kunstvoll in mehrere Bilder auf, indem er in der Wiederholung eines Objektes unter verschiedenen Gesichtspunkten dessen unterschiedliche Facetten zu erfassen sucht.
PhiN-Beiheft 3/2006: 35 5 Zur Deutung der Stilleben von Sebastian Stoskopff:
|
|
Le Strasbourgeois Stoskopff est un poète des reflets & des scintillements fugitifs: les amas de verre, dont il avait la passion, prennent pour lui un aspect fantastique & sorcier & dans le fond noir qui paraît les absorber on croit sentir le souffle du docteur Faust. (Kat. Paris 1934 : XLI). |
In der Folge haben verschiedene Autoren eine von geheimnisvollen Verweisen geprägte mystisch-melancholische Stimmung der Stoskopffschen Stilleben hervorgehoben (vgl. Haug 1952: 139 und 142; Haug 1961: 33; Faré 1962: I, 90; Faré 1974: 131).
PhiN-Beiheft 3/2006: 36
Sterling selbst konkretisierte seine Einschätzung später im Preface to the Second Revised Edition seines Stillebenbuches: "It is clear that the Alsatian Sébastien Stoskopff, although he learned a great deal in France, remained essentially Germanic; this is what I meant when I called him 'the Faustian wizard'." (Sterling 1981: 18; vgl. dazu auch Sterling 1959: 46).
Für Hans Haug ist ein Großteil der Stoskopffschen Stilleben von der Vanitasdarstellung beherrscht; eine Vorliebe, die er auf die Persönlichkeit des Künstlers und die entbehrungsreiche Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurückführt. Besonders die in der Straßburger Zeit entstandenen sogenannten intellektuellen Stilleben mit Büchern und wissenschaftlichen Instrumenten sind seiner Meinung nach dem Vanitasgedanken verpflichtet (vgl. Haug 1961: 33–35; Haug 1965: 76–80), während er in Stoskopffs bevorzugter Darstellung von Gläsern und Flaschen eine persönliche Vanitas des Künstlers zu erkennen meint. Dieser Gedanke findet sich bereits 1933 bei Abbé Brauner:
|
Seine grosse Vorliebe, kulinarische Objekte, dann Gläser, Becher und Branntweinflaschen auf die Leinwand zu bannen, war für ihn nicht nur ein schöpferischer und ästhetischer Kunstgenuss, sondern der Maler hat auch selbst allen diesen Dingen leider nur allzu fleissig zugesprochen. Der leidenschaftliche Genuss geistiger Getränke hat schliesslich seinen Tod beschleunigt. (Brauner 1933: 25). |
Die aus dem archivalisch verbürgten Säufertod des Malers abgeleitete Trunksucht wird an den häufig dargestellten Weingläsern und -flaschen dingfest gemacht, wobei der Schöpfer der Darstellungen für die halb geleerten Gefäße in mehr als nur künstlerischer Hinsicht verantwortlich gemacht wird (vgl. Haug 1948: 41; Haug 1952: 142; Haug 1961: 35).
Im Rahmen dieser Interpretationen fungieren Stoskopffs Bilder als Mahnung wider das ausschweifende Leben – des Malers Tod wird dabei zum abschreckenden Beispiel. Diese Lesart der Bilder verrät jedoch mehr über die Befindlichkeit des Kunsthistorikers als über die Intention des Künstlers.
Michel Faré setzt diese Tradition fort; auch für ihn zeichnet sich der Alkohol-Tod des Malers als Vorahnung in den Bildern ab – in der Verwendung so vieler Flaschen und Gläser, wie er doppeldeutig formuliert (Faré 1974: 132). Wie Hans Haug sieht er in Stoskopffs Stilleben vornehmlich Vanitasdarstellungen – verbildlichte Mahnungen der Vergänglichkeit und Flüchtigkeit irdischen Seins, geprägt von einem unübertroffen dramatischen Ausdruck, da der Maler von diesem Thema geradezu besessen gewesen sei.30
Die Ausstellung Stilleben in Europa in Münster und Baden-Baden verlegte sich durchgängig auf die allegorische Bildinterpretation.31 Mit Stoskopffs Gemälden beschäftigen sich Christian Klemm, Claus Grimm und Gerhard Bott (Klemm 1979: 140–218; Grimm 1979: 352–378; Bott 1979: 432–446).
PhiN-Beiheft 3/2006: 37
Sie deuten die dargestellten Eßwaren wie Fische, Nüsse und Früchte hauptsächlich christologisch, Gläserkörbe und Goldpokale als Vanitas sowie weitere Bilder allegorisch (z. B. Vier Elemente und Fünf Sinne). Der Schlußsatz von Gerhard Bott drückt in diesem Kontext fast Zweifel am Konzept der Ausstellung aus, wenn er nach seinen eigenen, durchgängig moralisierenden Bildinterpretationen schreibt: "Diese Unsicherheit der Inhaltsdeutung möge uns vor Überinterpretationen von Stilleben bewahren." (Bott 1979: 446).
Christopher Wright wendet sich gegen eine rein ikonographische Deutung der Bilder, argumentiert dabei jedoch unkünstlerisch, wenn er – ganz im Sinne von Svetlana Alpers Buch Kunst als Beschreibung – die Stoskopffschen Stilleben zur schlichten Abbildung von Alltagserfahrungen des Künstlers erklärt.32 Die häufig dargestellten Gläserkörbe beispielsweise zollten der Beobachtung Tribut, daß in der elsässischen Gastronomie leere Gläser bis heute lieber in einen Korb gehäuft, als auf einem Tablett balancierend getragen würden. Damit degradiert er den Maler zum reinen Chronisten und spricht ihm die Möglichkeit zum kunstvoll-künstlichen Arrangement ab, welches gerade den künstlerischen Wert von Stilleben ausmacht.
Birgit Hahn-Woernle hat mit ihrer Theorie vom protestantischen Andachtsbild eine neue Stilleben-Interpretation eingeführt. In den Kapiteln Bild und Religion sowie Sebastian Stoskopff und das protestantische Andachtsbild erläutert Hahn-Woernle ihre sehr eigene Vorstellung vom verborgenen, über symbolische Gegenstände ikonographisch entschlüsselbaren Sinngehalt von Stillebenmalerei, die im protestantischen Haus an Stelle des Kruzifixes die Funktion eines Andachtsbildes übernehmen konnte. Ihrer Theorie gemäß enthalten die meisten Gemälde von Stoskopff in Gegenständen wie Spanschachteln (als Hostien-Behältnisse), Fischen oder Früchten symbolische Hinweise auf Christi Opfertod und die davon ausgehende Heilsbotschaft (Hahn-Woernle 1996: 72–89).
Im Katalog der Stoskopff-Ausstellung in Straßburg und Aachen finden sich Ansätze, seine Stilleben ohne einseitig moralisierende Deutungen unter formalen Gesichtspunkten und bildimmanenten künstlerischen Aspekten zu betrachten. Fast schon programmatisch wirkt dabei Jacques Thuilliers einleitender Katalogbeitrag Pour un portrait de Stoskopff, der des Malers künstlerische Herkunft erläutert und aus dieser Tradition die üblichen Interpretationen als zu kurz greifend entlarvt (Thuillier 1997: 16–21, hier v. a. 20–21). Auch Michèle-Caroline Heck stellt formale Kriterien in den Mittelpunkt ihrer Beschäftigung mit Stoskopffs Werk und bezweifelt die Richtigkeit der moralisierenden Intention von Stillebenmalern im allgemeinen und Stoskopff im besonderen (vgl. Heck 1997: 38).
Wenn die aufgeführten Deutungen auch nicht generell zu bezweifeln sind – sicherlich beschreiben sie zumindest teilweise bildimmanente Themen – so wird doch mit dem Verzicht auf eine künstlerische Betrachtung der Bilder ein zentraler Aspekt der Stillebenmalerei vernachlässigt: ihre optischen Qualitäten.
PhiN-Beiheft 3/2006: 38
Diese aber sind, wie im folgenden gezeigt werden soll, von hoher Bedeutung für Stoskopffs Zeitgenossen und von daher besonders geeignet, Charakter und Eigenheit seiner Stillebenmalerei zu beleuchten.
Zum schwarzen Bildhintergrund
In der frühen Stillebenmalerei ist ein undefiniert dunkler Bildhintergrund weit verbreitet; erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts finden sich statt dessen vermehrt Scheinarchitekturen oder Landschaftsausblicke im Hintergrund. Durch einen schwarzen Fond lassen sich optische Qualitäten des Dargestellten wesentlich steigern. Bei Sebastian Stoskopff scheint der schwarze oder undefinierbar dunkle Raum zur Erhöhung der Plastizität des Dargestellten geradezu programmatisch zu sein.
Mit gesteigerter Taktilität der Objekte durch einen schwarzen Hintergrund beschäftigt sich Rudolf Preimesberger (vgl. Preimesberger 1991: 459–489, hier insbesondere 486–489) in seiner Untersuchung von Jan van Eycks sogenanntem Thyssen-Diptychon (Abb. 45). Anhand etymologischer Erläuterungen zu den Bezeichnungen diverser europäischer Sprachen für schwarzen Stein belegt er den sprachlichen Zusammenhang zwischen der Farbe Schwarz und der haptischen Qualität von Gemälden:
Eine ganze Gruppe schwarzer Steinsorten wurde im 15. Jahrhundert mit dem Terminus für den schwarzen Prüfstein von Goldschmieden benannt, wofür die Farbe das Kriterium war. In den Bezeichnungen zeigt sich eine zweite Bedeutungsebene, die dem Bereich des Malers nahesteht: im Deutschen wird schwarzer Stein Prüfstein, auch Probier-, Gold- und Streichstein genannt, wobei der Streich auch den Pinselstrich des Malers im Bild bezeichnet. Die Probier-, Streich- oder Strichnadel eines Goldschmiedes wird dabei zum Äquivalent des Gold-, Silber- oder Metallstifts des Malers. Im Italienischen wird der Streichstein zum Stein des prüfenden Vergleichs pietra di paragone. Der französischen Bezeichnung pierre de touche, verkürzt toucheau, liegt ein für das 13. Jahrhundert nachgewiesenes Substantiv touche zugrunde, welches dem deutschen Streich nahekommt (vgl. Preimesberger 1991: 488). Sowohl der deutsche Streich als auch das französische touche sind Wörter, denen ein Begriff für Berührung zugrunde liegt.
PhiN-Beiheft 3/2006: 39
Auch in der holländischen Bezeichnung des Prüfsteines, toetssteen, schwingt eine haptische Konnotation mit, da toets neben Probe und Test auch Taste bedeuten kann.
Preimesberger geht davon aus, daß van Eyck diese Wortanalogien geläufig gewesen sind und folgert dementsprechend:
|
So wie der Goldschmied das Metall, so scheint van Eyck die Feinheit der eigenen Linie an der unterscheidenden Kraft des Steins prüfen zu wollen. Sollte also der schwarze Stein, an dem die beiden gemalten Statuetten ihre körperliche Wirklichkeit für den Betrachter überprüfbar spiegelnd bewähren, zugleich als Prüfstein der in ihnen manifesten spektakulären Kunstleistung zu verstehen sein? Prüfstein und Spiegel der Malerei van Eycks in einem? (Preimesberger 1991: 489). |
Auf Sebastian Stoskopff bezogen, soll das Spiel der Worte zeitlich noch etwas weiter getrieben werden: Das französische Verb toucher, berühren, und das davon gebildete Substantiv touche, Berühren oder Taste, wurzeln in der volkslateinischen Schallmalerei tóccáre, (die Glocke) anschlagen (Gamillscheg 1928: 851). Daraus entwickelt sich die Bedeutung (schwarze) Farbe auftragen und liefert der deutschen Sprache das gleichbedeutende Verb tuschen, das jedoch auch schlagen oder stoßen bedeuten kann. Zuerst nachweisbar ist es 1618 in Augsburg, davor vereinzelt in der französischen Schreibweise touschen. Das daraus gebildete Substantiv Tusche erscheint zuerst 1711 in Leipzig (vgl. Grimm 1984: XXII, 1917–1918 und 1921–1926; Kluge 1995: 842; Mitzka 1956: VII, 172).
Die Wortanalogie zwischen der Bezeichnung für schwarze Farbe und dem Tastsinn spiegelt das Wissen der Zeitgenossen um deren inhaltlichen Zusammenhang. Sebastian Stoskopff, der sowohl des Deutschen als auch des Französischen mächtig war (seinen Bildern eingeschriebene Texte sind teilweise in Deutsch, teilweise in Französisch verfaßt), wird diese Parallele genauso geläufig gewesen sein wie Jan van Eyck. Daß die inhaltliche Anschauung zur praktizierten Darstellung vor schwarzem Hintergrund mit dem Ziel gesteigerter Plastizität beigetragen hat, liegt nahe. Neben dem ersichtlichen optischen Phänomen der Steigerung von Körperlichkeit und Taktilität vor dunklem Fond beinhalten Stoskopffs Stilleben diesen Gedanken wie gezeigt auch in sprachlich-intellektueller Form, die vom gebildeten Betrachter mit der Neigung zum Wortspiel erfaßt worden sein dürfte.
Ein weiterer Aspekt tritt hinzu: Bodo Vischer interpretiert in seinem Aufsatz über die Stilleben von Juan Sánchez Cotán (Vischer 1993: 269–308, hier vor allem 287–290), die mit Stoskopffs Arbeiten nicht nur zeitlich, sondern auch hinsichtlich des klaren Bildaufbaus und der isolierten Darstellung alltäglicher Gegenstände übereinstimmen, den schwarzen Fond der Bilder theologisch. Dabei ist insbesondere seine Definition der Bilddisposition als Verbindung haptischer Präsenz der Früchte und ungreifbarer Absenz des Hintergrundes bemerkenswert (vgl. Vischer 1993: 288).
PhiN-Beiheft 3/2006: 40
Unabhängig davon, wie die Gemälde interpretiert werden, scheint diese Konstellation der unbegreiflich plastischen Erscheinung des Dargestellten vor ungreifbar dunklem Hintergrund einen wesentlichen Teil der Attraktion früher Stillebenmalerei auszumachen33, wie auch im Fall des Holländers Johannes Torrentius gezeigt werden wird.
Die übergeordnete Bedeutung, die in der imitativen Malerei der Zeit eine schlüssige Wiedergabe der Gegenstände und die daraus wirkende optische Sensation gespielt hat, offenbart sich auch in der Verwendung und Wertschätzung der camera obscura. Das simple Prinzip der Lochbildkamera, die mittels eines kleinen Loches das Bild eines hellen Raumes in einen dunkleren projiziert, ermöglichte ein noch naturgetreueres Abbild der Welt.
Da der Gebrauch einer camera obscura in einem Gemälde keinerlei physische Spuren hinterläßt, ist ihre Anwendung praktisch nicht nachzuweisen. Festzustellen bleibt nur, ob ein Künstler die Möglichkeit gehabt haben könnte, sich ihrer zu bedienen und ob seine Bilder optische Phänomene aufweisen, die sich durch den Einsatz einer camera obscura erklären lassen. Zu den optischen Verschiebungen in einem durch die camera erzeugten Bild zählen Verzerrungen, Unschärfen, ein auf bestimmte Bildpartien gerichteter Fokus und deren vom übrigen Bild scheinbar unterschiedliche Ausarbeitung durch den Künstler sowie die stark in den Vordergrund tretende Intensität von Lichtreflexen.
All diese Phänomene können vom Maler jedoch ausgeglichen werden und bieten daher keinen sicheren Anhaltspunkt. Jan Vermeers Bilder sind das klassische Beispiel für den Versuch von Kunsthistorikern, die Verwendung dieses optischen Gerätes nachzuweisen. Nahezu alle Besonderheiten des Vermeerschen Malstils sind irgendwann einmal mit der camera obscura erklärt worden, ohne daß sich solche Behauptungen verifizieren ließen (zur künstlerischen Verwendung der camera obscura vergleiche vor allem Wheelock 1977a: 163 ff.; Wheelock 1977b: 93–103; Alpers 1985: 57–61, 83–95 und 115–118).
Stoskopffs Kunst läßt in der Beschränkung auf die Arbeit nach der Natur und im künstlerischen Arrangement von Gegenständen – Stilleben per definitionem also – die Anwendung einer camera obscura möglich und sinnvoll erscheinen. Aufgrund optischer Phänomene wie Verzerrungen, Unschärfen und fokussierten Bildpartien sowie der hohen Intensität von Lichtreflexen vor allem auf Glas stellt sich diese Frage mit Nachdruck. Woher aber mag der Künstler ein solches optisches Gerät gekannt und zu seiner Verfügung gehabt haben?
PhiN-Beiheft 3/2006: 41
Das Prinzip einer Lochkamera ist altbekannt und findet sich schon in Ibn al-Haitham Alhazens Lehrbuch der Optik aus dem frühen 11. Jahrhundert (zur Entwicklung der camera obscura vergleiche vor allem Hammond 1981 und Lindberg 1987 mit ausführlichen Literaturhinweisen). Für das 16. Jahrhundert ist sie als Zeichenhilfe erstmals in künstlerischem Gebrauch belegt (vgl. Hammond 1981: 40). Ob Leonardo, der sich ausführlich mit der camera obscura beschäftigt hatte (vgl. u. a. Lindberg 1987: 279 und 289 ff.), sich ihrer auch bediente, entzieht sich unserer Kenntnis. Die Verbesserung der Projektion durch die Verwendung einer Linse im Loch der camera war maßgeblich dem Traktat Magia naturalis (1558) von Giovanni Battista della Porta zu verdanken, und in Daniele Barbaros La Practica della Perspettiva (Venedig 1569) findet sich eine Beschreibung für Künstler über Nutzen und Bau einer camera obscura (vgl. Lindberg 1987: 322–323; Wheelock 1977b: 96–97; Hammond 1981: 15–19).
Wohl zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde aus dem Prinzip der immobilen camera, dem Raum mit einem Loch in der Wand, eine portable Lochkamera entwickelt. Wie Maurice Daumas ausführt (Daumas 1953: 28–30), ist die Entstehung optischer Instrumente um 1600 als Eigenbau von Wissenschaftlern mit handwerklicher Hilfe anzusehen, bis im Verlauf des 17. Jahrhunderts eine Art optische Industrie entstand, die im 18. Jahrhundert auch die camera obscura seriell herstellte (vgl. auch Hammond 1981: 40). Zwei schriftliche Zeugnisse um 1620 belegen die Existenz portabler Geräte: In einem Brief von 1620 berichtet Sir Henry Wotton, daß er bei Johannes Kepler in Linz eine bewegliche Zelt-camera gesehen habe; eine Zeichnung dieser camera in Keplers Papieren belegt diese Angabe (siehe Wheelock 1977b: 99; Hammond 1981: 25; Alpers 1985: 115–118).
Constantijn Huygens, der sich 1622 bei Cornelis Drebbel in London aufgehalten und in einem Brief von dessen camera berichtet hatte, brachte im Anschluß an seine Reise eine camera obscura nach Den Haag. Portable Lochkameras sind demnach, so folgert Wheelock (Wheelock 1977b: 99), bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts wahrscheinlich, und holländische Künstler konnten ihrer in den 1620er Jahren habhaft werden.
Da sich Stoskopff sowohl in Hanau als auch in Paris in einem künstlerischen Umfeld bewegte, das stark von niederländischen Malern beeinflußt war, wird er wahrscheinlich auf diesen Wegen auch von der camera obscura Kenntnis erhalten haben, spätestens jedoch in seiner Pariser Zeit.
Ob sich der Maler tatsächlich einer Camera bediente, ist dabei weniger wesentlich als der Umstand, daß er einer Zeit entstammt, die großen Wert auf präzise optische Wiedergabe legt, so daß ihr zu diesem Zweck die Verwendung technischer Gerätschaften noch über die künstlerische Erfindung geht. Denn in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war die camera obscura für Künstler weit mehr als nur ein Hilfsmittel für Zeichnung und Perspektive. Der begeisterte Brief Huygens' vom 13. April 1622 an seine Familie zeugt davon:
PhiN-Beiheft 3/2006: 42
|
J´ay chez moy l´autre instrument de Drebbel, qui certes fait des effets admirables en peinture de reflexion dans une chambre obscure; il ne m´est possible de vous en declarer la beauté en paroles; toute peinture est morte au prix, car c´est icy la vie mesme, ou quelque chose de plus relevé, si la parole n´y manquoit. Car et la figure et le contour et les mouvements s´y recontrent naturellement et d´une façon grandement plaisante.34 |
Für Arthur Wheelock stellt die zitierte Begeisterung ein Zeitphänomen dar, da sich ähnliche Formulierungen auch in Kunsttraktaten der Zeit finden (Wheelock 1977b: 93–95; vgl. auch Alpers 1985: 83–85). Der enthusiastische Kommentar über ein vollkommen naturalistisches Abbild der Welt, das Huygens "das Leben selbst, oder etwas noch Erhabeneres" nennt und als der Malerei überlegen bezeichnet, macht die Beliebtheit und schnelle Verbreitung der camera obscura im 17. Jahrhundert nachvollziehbar. Das mit ihrer Hilfe gemalte Bild erfährt eine entsprechende Aufwertung, wenn es dem Maler gelingt, die Unmittelbarkeit der Projektion auf seine Leinwand zu bannen.35 Welche Wirkung Malerei dieser Art erzielen kann, berichtet Constantijn Huygens in seiner 1629 erschienenen Autobiographie am Beispiel des Johannes Torrentius.
|
Ich denke, daß die an der Malerei Interessierten, die diese Seiten lesen, besonders von mir erwarten, daß ich Johannes Torrentius nicht unbesprochen lasse. Ich bin dann auch gern bereit, was seine Malerei betrifft, zu erklären, daß der Mann meiner Meinung nach in der Wiedergabe von leblosen Gegenständen ein Wunder scheint. Ich glaube nicht, daß schnell jemand daher kommen wird, der imstande ist, Gegenstände aus Glas, Zinn, Ton und Eisen, die eine besondere Art Glanz haben und die man eigentlich zu schwierig erachtete für den Pinsel, mit so viel Ausdruckskraft und mit solch subtiler Schönheit abzubilden weiß. [...] |
|
Torrentius aber läßt alle, die etwas von seinem Werk verstehen wollen, im Ungewissen, und alle Diskussionen über seine Anwendung einer abweichenden Art von Pigment, von Öl und, nicht zu glauben, selbst von Pinsel haben bisher auch nichts erbracht. Dieser Unsicherheit der ernsthaften Kritik hat man sich bedient. Der Maler selbst nämlich, ein meisterlicher Scharlatan, oder seine Anhänger, größtenteils große Nullen, haben das unsinnige Gerücht in die Welt gebracht, daß dem Pigment, sobald es durch seine geradezu göttliche Hand gerieben sei, Harmonieklänge entlockt würden. Genauso wie die Harmonie der Sphären, die einige Philosophen von der gleichen wahrheitsliebenden Sorte uns weismachen wollen. (Deutsche Übersetzung zitiert nach König / Schön 1996: 233–235). |
Die Wirkung dieser perfekten Stilleben habe bei Torrentius' Anhang den Eindruck "von himmlischer Verführung mit der Gabe dieser unbekannten Kunst" erweckt, so Constantijn Huygens, der sich beflissen davon distanziert, da es mit der "ein für allemal gegebenen Inspiration" nicht weit her sein könne, wenn wie bei Torrentius die "Darstellung von Menschen und anderen Lebewesen [...] so schändlich primitiv" und daher "für wahre Kenner keines Blickes" würdig sei.
PhiN-Beiheft 3/2006: 43
Die Faszination des Menschen Torrentius kann er sich nicht erklären, für die überwältigende optische Sensation der von Torrentius gemalten Stilleben findet Huygens "neben seinem alleinigen Talent als Maler" jedoch eine Erklärung (alle Zitate nach König / Schön 1996: 234): Bei einer Vorführung seiner camera obscura, die Huygens 1622 von Drebbel aus England mitgebracht hatte, war auch Johannes Torrentius zugegen, der das optische Gerät mit gespielter Unwissenheit und großer Neugierde in Augenschein nahm; Huygens berichtet:
|
Der Gedanke kam über mich, daß er sehr wohl über die Erfindung [die Lochkamera] auf der Höhe war, aber daß er den Eindruck erwecken wollte, es nicht zu sein. Unter Beifall der de Gheyns habe ich später selbst feststellen können, daß der schlaue Fuchs gerade mit Hilfe dieses Instruments beim Malen den Effekt erzielte, den das einfältige, unkritische Publikum an seiner Malweise so oft göttlicher Inspiration zugeschrieben hat. Meine Vermutung wurde insoweit bestärkt, als die Ähnlichkeit zwischen Malereien von Torrentius und den Silhouetten frappierend ist, und folglich, daß seine Kunst, verglichen mit dem wirklichen Objekt, etwas Ungreifbares, etwas Vollkommenes hat. Man nimmt wahr, daß das für die Zuschauer unverkennbar anwesend ist. (Zitiert nach König / Schön 1996: 235). |
Folgen wir Huygens, gelingt es Torrentius mittels einer camera obscura36, seinen Stilleben eine solch große Unmittelbarkeit und Lebendigkeit zu verleihen, daß das fachkundige Publikum begeistert ist und der unwissende Betrachter sogar an übersinnliche Fähigkeiten denkt. Offenbar, so Eberhard König (vgl. König / Schön 1996: 235–238), hatte man sich so an die unvollkommen, aber begreifbar erscheinende Naturnachahmung in der Malerei gewöhnt, daß die stofflich schlüssig dargebotenen Stilleben des Torrentius dem Betrachter den Eindruck unbegreiflicher Vollkommenheit vermitteln. Die dem Kenner erklärbare optische Sensation muß dem Unwissenden als göttliche Inspiration erscheinen.
Für Stoskopffs Stilleben fehlt solche Panegyrik. Einige der Gemälde von Sebastian Stoskopff zeigen auffällige Parallelen zu dem sogenannten Stilleben mit Kandare von Johannes Torrentius aus dem Jahr 1614 im Amsterdamer Rijksmuseum (vgl. Kat. Amsterdam 1993: 605–606), dem einzigen Bild, das heute noch von Torrentius' Kunstfertigkeit zeugt (Abb. 46).
PhiN-Beiheft 3/2006: 44
Dessen Bildauffassung – monumentale Darstellung der Objekte sowie ihre linear-parataktische Aufreihung, die Materialität der dargestellten Gegenstände und ihre taktile Qualität vor schwarzem Fond – findet in Stoskopffschen Stilleben wie dem Exemplar in Köln (vgl. Hahn-Woernle 1996: 150–151), dem Pariser Gemälde mit Juno-Statuette im Louvre (vgl. Hahn-Woernle 1996: 186–187) oder dem in Privatbesitz befindlichen Stilleben mit Turbopokal (vgl. Hahn-Woernle 1996: 188–189) deutliche Entsprechung (Abb. 18, 39 und 48). Dieser Umstand wurde bereits 1934 von Pieter de Boer vermerkt, der die von zwei Stoskopff-Tafeln ausgehende "eigentümliche, beinahe geheimnisvolle Stimmung" am ehesten mit Torrentius oder Vrel vergleichbar hält;37 in der Forschung wurde dieser Ansatz jedoch nicht weiter verfolgt.
Der auf optischer Sensation beruhende Eindruck Stoskopffscher Stilleben dürfte dem von Huygens beschriebenen vergleichbar sein. Diese frappierende Wirkung einer an vertrauten Objekten demonstrierten veränderten Sichtweise durch präzise Darstellung läßt sich mit dem Gedankengut des Neuplatonismus stützen, wie Eberhard König für Torrentius ausgeführt hat (vgl. König / Schön 1996: 237 und 62–63). Konkret nachzuweisen sind philosophische Grundlagen für Stoskopffs Malerei jedoch nicht. Humanistische Bildung und philosophische Kenntnis dürfen für den Künstler allerdings vorausgesetzt werden und bilden den geistigen Hintergrund seines Schaffens.
Straßburg ist im 17. Jahrhundert als Druckerei- und Verlagsstadt ein geistig äußerst reger Ort. Konfessionelle Auseinandersetzungen zwischen Lutheranern, Reformierten und Katholiken sorgten ebenso für lebhaften Disput wie zahlreiche Wissenschaftler der 1621 zur Universität erhobenen protestantischen Akademie. Von den Wirrnissen des Dreißigjährigen Krieges verhältnismäßig verschont, waren in Straßburg Kunst- und Raritäten-Kabinette ebenso zugänglich wie öffentliche Bibliotheken (zur geistigen und kulturellen Situation Straßburgs im 17. Jahrhundert vgl. vor allem Hermann 1819: II, 368–369 (sociétés littéraires), 372 ff. (bibliothèques) und 413–422 (imprimeurs et leurs ouvrages); Strobel 1844/46: IV, 247–268 (1538–1618), 477–489 (1618–1648); V, 194–238 (1648–1789).
Zweifelsohne darf somit für Straßburg die Virulenz geistiger Strömungen der Zeit angenommen werden, die Stoskopff, dessen Kontakte zu gebildeten Persönlichkeiten immer wieder betont werden, vor solchem Hintergrund zur Kenntnis gelangt sein könnten (vgl. Haug 1948: 36 ff.; Hahn-Woernle 1996: 18 und 87–88; Heck 1997: 38 und 42–45).
Als getaufter Protestant und Sohn eines städtischen Diplomaten dürfte Stoskopff die protestantische Akademie in Straßburg besucht und dort eine umfassende Bildung genossen haben (vgl. Heck 1997: 29 und Anm. 18). Die sorgfältige Auswahl der auswärtigen Lehrstelle fiel mit dem Wallonen Daniel Soreau als Lehrherr auf mehr als einen nur handwerklich beschlagenen Meister.
PhiN-Beiheft 3/2006: 45
Der Wollhandelskaufmann Soreau, der sich erst im Alter den Künsten zugewandt hatte, war offenbar den humanistischen Idealen der Renaissance verpflichtet (vgl. Thuillier 1997: 20–21). Das Nachlaßinventar der Familie Soreau von 1621 katalogisiert neben Kunstgegenständen und Bildern vor allem eine umfangreiche Bibliothek.38 Künstlerische Betätigung gehörte für Daniel Soreau zu umfangreicherer humanistischer Bildung. Dementsprechend teilte er zu Beginn von Stoskopffs Lehrzeit dem Straßburger Rat mit, daß er den Zögling neben den Künsten auch die Laute schlagen und Ball spielen lehre und daß er einen Albrecht Dürer aus ihm zu machen gedenke (vgl. Brauner 1933: 42–43). Diesem Ideal des universalen Renaissancekünstlers folgte Stoskopff nicht, sondern konzentrierte sich hauptsächlich auf die Stillebenmalerei.
Schon Daniel Soreau scheint der Malerei als imitatio naturae verpflichtet gewesen zu sein, eine für Stoskopff prägende Erfahrung (vgl. Thuillier 1997: 20–21). Nachahmung der Natur wird in neoplatonischem Sinne als Hommage an die Schöpfung Gottes, als Suche nach dem Wesen der Gegenstände und der Harmonie ihrer Erscheinungen sowie als Teilhabe an der Welt des Schönen verstanden. Die von Plotin begründete Aufwertung imitativer Kunst, die den Idealen der Natur gleichkommt und sie in Schönheit sogar überflügelt (vgl. Plotin 1905: I, 57–58), spiegelt sich in der kunsttheoretischen Auffassung des Lodovico Dolce (1557): Ein hart arbeitender Künstler könne die Natur übersteigen, indem er bei deren Imitation ihre Fehler ausbessere (vgl. Lee 1940: 204–205; Bialostocki 1988: 64–68). Oben dargelegtes Interesse an den optischen Phänomenen und Qualitäten der Malerei, das Stoskopff mit gebildeten Zeitgenossen teilte, zielt durch die imitatio naturae in neoplatonischem Sinne auf die Überflügelung der Natur.
6 Schlußbetrachtung
Vor diesem Hintergrund stellt sich Stoskopffs Stillebenmalerei als schlüssiges Konzept dar: Die kunstvolle Darstellung vertrauter Dinge bietet dem Betrachter neben optischen Sensationen eine veränderte Sichtweise der Gegenstände. Stoskopffs künstlerisches Interesse verbindet sich mit der begrifflichen Idee des Objekts. Die häufig als Stoskopffschen Stilleben innewohnend beschriebene Stimmung, die sich in der beseelten Präsenz der Gegenstände manifestiert, wird durch die zeitgenößößische Philosophie des Pantheismus oder die Naturphilosophie des Paracelsus gestützt.
Die Fertigkeit des Malers in der Darstellung von Stofflichkeit wird nicht nur durch die präzise Abbildung der Objekte, zum Beispiel mit Hilfe einer camera obscura, zum überwältigenden sinnlichen Erlebnis, sondern auch die Anordnung der Gegenstände; der Bildausschnitt sowie Licht und Farbe vermitteln eine Präsenz und Monumentalität, die Vorstellungen von übersinnlichem, ja göttlichem Ursprung des Dargestellten zulassen. Dabei ist es gerade das oben beschriebene paradoxe Spannungsfeld der 'unbegreiflich-greifbaren' Darstellung, welches den Eindruck einer göttlichen Pinselführung erweckt oder, für den aufgeklärten Betrachter, doch zumindest die Faszination dieser Bilder ausmacht.
PhiN-Beiheft 3/2006: 46
Diesbezüglich war Stoskopff ein großer Meister seines Fachs. Kann daraus ein neues Künstler-Selbstverständnis abgeleitet werden, nachdem die Arbeit in dem als am geringsten erachteten Bereich der Malerei die größten künstlerischen Entfaltungsmöglichkeiten bot? Wählte Stoskopff trotz seiner universalen Ausbildung das Stilleben, weil in dieser Gattung am wenigsten konventionelle Vorgaben existierten und es daher möglich war, seinen künstlerischen Interessen und Neigungen freier zu folgen? Die vorangegangenen Ausführungen scheinen dies zu stützen.
Nicht zu vergessen ist, daß sich das Stilleben in der Folgezeit zur Schlüsselgattung der Moderne entwickelte, in der realistische Darstellung und Nachahmungscharakter der Kunst früher als in anderen Gattungen hinter das subjektive, am Künstlerischen orientierte Betrachterurteil gestellt wurden.39 Stoskopffs in manchen Bildpartien reduzierte, gelegentlich fast abstrakt wirkende Darstellungsweise deutet auf eine Entwicklung hin, die etwa hundert Jahre später Jean-Baptiste Siméon Chardin aufnehmen und die zu den expressiven Stilleben der klassischen Moderne führen sollte.
Gemessen an solchen Überlegungen erscheint die überwiegende Einschätzung der Stoskopffschen Stillebenmalerei wenig charakteristisch und ihre immer gleiche Deutung zu eindimensional. Oder, wie es Jacques Thuillier formuliert:
|
Einige Erdbeeren, eine Orange, ein Brot, ein toter Hase, eine Terrine, der kalte Glanz eines kostbaren Metalls brauchen keine symbolische Bedeutung, die ohnehin nur ein armseliger Vorwand sein könnte.40 |
Bibliographie
Alpers, Svetlana (1985): Kunst als Beschreibung. Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Köln.
Bauer, Hermann (1992): Barock. Kunst einer Epoche. Berlin.
Bénézit, Emmanuel (1999): Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Nouvelle édition entièrement refondue sous la direction de Jacques Busse. Paris.
Berger, Silvia (1987): "Sebastian Stoskopff und sein Mäzen Graf Johannes von Nassau-Idstein", in: Kat. Idstein 1987, 34–63.
Bialostocki, Jan (1988): "The Renaissance Concept of Nature and Antiquity", in: Bialostocki, Jan: The Message of Images. Wien. 64–68.
Böhmer, Sylvia (1997): "Imitation et invention picturale – les gravures peintes dans les natures mortes de Sébastien Stoskopff", in: Kat. Straßburg 1997. 94–107.
PhiN-Beiheft 3/2006: 47
de Boer, Pieter (1934): "A. Kopff", in: Kat. Amsterdam 1934. 63.
Bott, Gerhard (1962): "Stillebenmaler des 17. Jahrhunderts: Isaak Soreau – Peter Binoit", in: Kunst in Hessen und am Mittelrhein. 27–93.
Bott, Gerhard (1979): "Gemalte Schätze. Erinnerung an die Vergänglichkeit alles Irdischen wie Mittel zur Repräsentation", in: Kat. Münster/Baden-Baden 1979/80. 432–446.
Bott, Gerhard (1993): "Der Stillebenmaler Daniel Soreau und seine Schule", in: Kat. Frankfurt 1993/94. 234–240.
Bott, Gerhard (1997): "L´apprentissage de Sébastien Stoskopff à Hanau. 1615–1621", in: Kat. Straßburg 1997. 60–75.
Bott, Gerhard (2001): Ein Stück von allerlei Blumenwerk – ein Stück von Früchten – zwei Stück auf Tuch mit Hecht. Die Stillebenmaler Soreau, Binoit, Codino und Marrell in Hanau und Frankfurt 1600–1650. Hanau.
Bott, Heinrich (1971): Gründung und Anfänge der Neustadt Hanau 1596–1620. 2 Bde. Hanau.
Bottari, Stefano (1964): "Nature Morte della scuola di Francoforte. J. Soreau, Peter Binoit e Francesco Codino", in: Pantheon XXII. 107–114.
Brauner, Joseph (1933): Sebastian Stosskopf. Ein Strassburger Maler des 17. Jahrhunderts 1597–1657. Straßburg.
Bryson, Norman (1990): Looking at the Overlooked. Four Essays on Still Life Painting. London.
Burda, Christa (1969): Das Trompe-l´œil in der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. München.
Citroen, Karel (1997): "Sébastien Stoskopff et l´orfèvrerie", in: Kat. Straßburg 1997. 108–117.
Daumas, Maurice (1953): Les instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris.
Dietz, Alexander (1922): "Straßburg und Frankfurt a. M. Eine Städtefreundschaft", in: Elsaß-Lothringisches Jahrbuch 1. 49–67.
Dupeux, Cécile (1997): "Sébastien Stoskopff dans les collections des Musées de Strasbourg. Un artiste emblématique", in: Kat. Straßburg 1997. 22–27.
PhiN-Beiheft 3/2006: 48
Ebert-Schifferer, Sybille (2002): "Trompe l'Oeil. The Underestimated Trick", in: Kat. Washington 2002/2003. 17–37.
Faré, Michel (1962): La Nature Morte en France. Son histoire et son évolution du XVIIe au XXe siècle. 2 Bde. Genf.
Faré, Michel (1974): Le grand siècle de la Nature Morte en France. Le XVIIe siècle. Fribourg.
Faré, Fabrice und Chevé, Dominique (1996): "Les tableaux de trompe-l´œil ou la dénonciation de l´illusion au XVIIe siècle", in: Mauriès, Patrick (Hrsg.): Le Trompe-l´œil de l´Antiquité au XXe siècle. Paris. 115–167.
Fleischhauer, Werner (1976): Die Geschichte der Kunstkammer der Herzöge von Württemberg in Stuttgart. Stuttgart.
Gamillscheg, Ernst (1928): Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache. Heidelberg.
Grimm, Claus (1979): "Küchenstücke – Marktbilder – Fischstilleben," in: Kat. Münster/Baden-Baden 1979/80. 352–378.
Grimm, Claus (1988): Stilleben. Die niederländischen und deutschen Meister. Stuttgart/Zürich.
Grimm, Claus (1995): Stilleben. Die italienischen, spanischen und französischen Meister. Stuttgart/Zürich.
Grimm, Jacob und Wilhelm (1984): Deutsches Wörterbuch. Bd. 22. München.
Gruber, Alain (1983): "Un autoportrait caché dans la peinture du XVIIe siècle", in: Deuchler, Flury-Lemberg, Otavsky (Hrsg.): Von Angesicht zu Angesicht. Porträtstudien. Michael Stettler zum 70. Geburtstag. Bern. 212–215.
Habert, Jean (1991): R. F. 1989–29. "Vanité au cadran solaire", in: Musée du Louvre. Nouvelles acquisitions du Département des Peintures (1987–1990). Paris. 94–97.
Hahn-Woernle, Birgit (1996): Sebastian Stoskopff. Mit einem kritischen Werkverzeichnis der Gemälde. Stuttgart.
Hammond, John H. (1981): The Camera Obscura. A Chronicle. Bristol.
Haug, Hans und Riff, Adolphe (1932): Musées de la Ville de Strasbourg. Compte-rendu des années 1927–1931. Straßburg.
PhiN-Beiheft 3/2006: 49
Haug, Hans (1948): "Sébastien Stoskopff. Peintre de natures mortes (suivi du catalogue critique de l´œuvre)", in: Trois siècles d´art alsacien 1648–1948. Édition des archives alsaciennes d´histoire de l´art. Straßburg und Paris. 23–72.
Haug, Hans (1952): "Trois peintres strasbourgeois de natures mortes", in: La Revue des Arts II. 137–150.
Haug, Hans (1959): "Deux nouveaux tableaux strasbourgeois du XVIIe siècle", in: La Revue des Arts IX. 283–292.
Haug, Hans (1961): "Sébastien Stoskopff", in: La Revue L´Œil 76. 22–35.
Haug, Hans (1965): "Une nature morte de Sébastien Stoskopff au Musée de Lyon et deux autres œuvres inédites du maître", in: Bulletin des Musées et Monuments Lyonnais 4. 75–82.
Haug, Hans (1978): L´Orfèvrerie de Strasbourg dans les collections publiques françaises. Paris.
Heck, Michèle-Caroline (1993): "Der Einfluß Georg Flegels auf Sebastian Stoskopff", in: Kat. Frankfurt 1993/94. 241–246.
Heck, Michèle-Caroline (1997): "Sébastien Stoskopff. Sa vie. Son œuvre", in: Kat. Straßburg 1997. 28–59.
Heck, Michèle-Caroline (1999) : "A propos d'un 'Bouquet de fleurs' du début du XVIIe siècle du Musée de l'Œuvre Notre-Dame de Strasbourg : de l'importance des modèles gravés pour les peintres", in : Cahiers alsaciens d'archéologie d'art et d'histoire XLII. 191-199.
Herbert, Zbigniew (1994): Stilleben mit Kandare. Skizzen und Apokryphen. Frankfurt.
Hermann, Jean-Frédéric (1819): Notices historiques, statistiques et littéraires, sur la ville de Strasbourg. 2 Bde. Straßburg.
Holzhausen, Walter (1944): "Ein Werk des Sebastian Stosskopf", in: Pantheon XXXII. 111–112.
Houbraken, Arnold (1719): De groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en schilderessen. 3 Bde. Amsterdam.
Kat. Amsterdam 1934: De helsche en de Fluweelen Brueghel en hun invloed op de kunst in de Nederlanden. Tentoonstelling in de Kunsthandel Pieter de Boer.
Kat. Amsterdam 1993: Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580–1620. Rijksmuseum.
PhiN-Beiheft 3/2006: 50
Kat. Amsterdam/Braunschweig 1983: Niederländische Stilleben. Von Brueghel bis van Gogh. Kat. von Sam Segal. Kunsthandel Pieter de Boer Amsterdam und Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig.
Kat. Frankfurt 1993/94: Georg Flegel (1566–1638). Stilleben. Hrsg. v. Kurt Wettengl. Historisches Museum in Zusammenarbeit mit der Schirn Kunsthalle.
Kat. Idstein 1987: Sebastian Stoskopff. Sein Leben. Sein Werk. Seine Zeit. Stadthalle.
Kat. Münster/Baden-Baden 1979/80: Stilleben in Europa. Hrsg. v. Gerhard Langemeyer. Westfälisches Landesmuseum Münster und Staatliche Kunsthalle Baden-Baden.
Kat. Paris 1934: Les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle. Musée de l´Orangerie.
Kat. Paris 1952: La Nature Morte de l´antiquité à nos jours. Orangerie des Tuileries.
Kat. Straßburg 1997: Sébastien Stoskopff 1597–1657. Un maître de la nature morte. Musée de l´Œuvre Notre-Dame.
Kat. Washington 2002/2003: Deceptions and Illusions. Five Centuries of Trompe l'Oeil Painting. National Gallery of Art.
Klemm, Christian (1979): "Weltdeutung – Allegorien und Symbole in Stilleben", in: Kat. Münster/Baden-Baden 1979/80. 140–218.
Kluge, Friedrich (1995): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearb. v. Elmar Seebold. Berlin und New York.
König, Eberhard und Christiane Schön (1996): Stilleben. Berlin.
König, Eberhard (1996): "Stilleben zwischen Begriff und künstlerischer Wirklichkeit", in: König / Schön. 13–92.
Laveissière, Sylvain (1982): "Pierre Nichon identified", in: The Burlington Magazine 124. 704.
Lee, Rensselaer W. (1940): "Ut pictura poesis: The Humanistic Theory of Painting", in: The Art Bulletin XXII. 197–269.
Lentz, Christel (1990): "Die Erziehung eines künftigen nassauischen Regenten im 17. Jahrhundert", in: Heimatjahrbuch des Rheingau-Taunus-Kreises 41. 165–172.
Lentz, Christel (1992): "Kunst am Idsteiner Hofe. Über das Verhältnis des Grafen Johannes von Nassau-Idstein zu Kunst und Künstlern", in: Heimatjahrbuch des Rheingau-Taunus-Kreises 43. 167–169.
PhiN-Beiheft 3/2006: 51
Lentz, Christel (1994a): "Sebastian Stoßkopff, der Maler von Straßburg", in: Cahiers alsaciens d´archéologie d´art et d´histoire XXXVII. 163–172.
Lentz, Christel (1994b): "Sebastian Stoßkopff, Stillebenmaler und Portraitist 1597–1657", in: Hessische Heimat. Zeitschrift für Kunst, Kultur und Denkmalpflege 44. 3–11.
Lentz, Christel (1994c): Das Idsteiner Schloß. Beiträge zu 300 Jahren Bau- und Kulturgeschichte. Idstein.
Lieure, Jules (1924): Jacques Callot. 8 Bde. Paris.
Lindberg, David C. (1987): Auge und Licht im Mittelalter. Die Entwicklung der Optik von Alkindi bis Kepler. Frankfurt.
Lipp, Peter A. (1996): "Zu Maltechnik und Malmitteln Sebastian Stoskopffs", in: Hahn-Woernle. 96–101.
Mette, Hanns-Ulrich (1997): "Œuvres d´art et curiosités: à propos des natures mortes aux coquillages de Sébastien Stoskopff", in: Kat. Straßburg 1997. 126–129.
Mitzka, Walther (1956): Trübners Deutsches Wörterbuch. Bd. 7. Berlin.Müller, Wolfgang J. (1956): Der Maler Georg Flegel und die Anfänge des Stillebens. Frankfurt.
Müller, Wolfgang J. (1987): "Die Stilleben-Bildkunst des Sebastian Stoskopff", in: Kat. Idstein 1987. 10–33.
Plotin (1905): Enneaden. In: Auswahl übersetzt und eingeleitet von Otto Kiefer. Bd. 1. Jena und Leipzig.
Polaczek, Ernst (1922): "Das Straßburger Tagebuch des Johann Friedrich von Uffenbach aus Frankfurt (1712–1714)", in: Elsaß-Lothringisches Jahrbuch 1. 68–122.
Preimesberger, Rudolf (1991): "Zu Jan van Eycks Diptychon der Sammlung Thyssen-Bornemisza", in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 54. 459–489.
Rosenberg, Pierre (1983): "'Statuette, livres, boîte de copeaux et coquillages' et 'Livres, chandelle et statuette de bronze'", in: Musée du Louvre. Nouvelles acquisitions du Département des Peintures (1980–1982). Paris. 15–17.
Rott, Hans (1930): "Straßburger Kunstkammern im 17. und 18. Jahrhundert", in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. N. F. Bd. 44. 1–46
PhiN-Beiheft 3/2006: 52
Sandrart, Joachim (1675): Teutsche Academie der Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste. 3 Bde. Nürnberg.
Schwarz, Sabine (1987): Das Bücherstilleben in der Malerei des 17. Jahrhunderts. Wiesbaden.
Sterling, Charles (1959): La Nature Morte de l´antiquité à nos jours. Paris.
Sterling, Charles (1981): Still Life Painting from Antiquity to the Twentieth Century. Second Revised Edition. New York.
Strobel, Adam Walther (1844/1846): Vaterländische Geschichte des Elsasses. Von der frühesten bis auf die gegenwärtige Zeit. 6 Bde. Straßburg.
Thieme, Ulrich und Becker, Felix (1938): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. Hrsg. v. Hans Vollmer. Bd. XXXII. Leipzig.
Thuillier, Jacques (1997): "Pour un portrait de Stoskopff", in: Kat. Straßburg 1997. 16–21.
Tummers, Anna (2002): "Kat. 34", in: Kat. Washington 2002/2003. 187.Vischer, Bodo (1993): "La transformación en dios. Zu den Stilleben von Juan Sánchez Cotán (1560–1627)", in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft Bd. 38/2. 269–308.
Wheelock, Arthur K. (1977a): Perspective, Optics, and Delft Artists around 1650. New York und London.
Wheelock, Arthur K. (1977b): "Constantijn Huygens and Early Attitudes towards the camera obscura", in: History of Photography 1. 93–103.
Wölfflin, Heinrich (1943): Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst. München.
Wright, Christopher (1985): The French Painters of the Seventeenth Century. Boston.
Anmerkungen
1 "Stoskopff, sorcier faustien des reflets évanescents du verre, qui subira à Paris l'influence du goût français." (Sterling 1959: 46).
PhiN-Beiheft 3/2006: 53
2 Tatsächlich stellt Stoskopff die Kunstgeschichte, die ihre Künstler gerne in nationale Schulen einteilt, vor ein gewisses Problem, da sich der gebürtige Elsässer, der lange in Frankreich wie auch in Deutschland gelebt hat, einer staatlichen Zuordnung ebenso entzieht wie seine Geburtsstadt Straßburg in jener Zeit. Selbst im Pariser Louvre ist man sich daher uneinig, ob Stoskopff der deutschen oder französischen Schule zuzurechnen sei: Jean Habert (Habert 1991: 94–97) rechnet ihn der Ecole française zu, Pierre Rosenberg (Rosenberg 1983, 15 ff.) der Ecole allemand.
3 Es ist davon auszugehen, daß Sebastian zuvor bei einem Straßburger Meister in die Lehre gegangen ist. Hans Haug schlug den Miniaturisten Friedrich Brentel vor (zuerst Haug 1948: 26), der in der folgenden Literatur meist als Stoskopffs Lehrer bezeichnet wird. Nach Michèle-Caroline Heck (Heck 1997: 29), besuchte Stoskopff "zweifellos" das Atelier Brentels, des einzig bedeutenden Straßburger Künstlers dieser Zeit, der ihm die Kunst der Zeichnung und des Kupferstichs vermittelt habe. Da Brentel im erwähnten Protokoll vom Dezember 1615 als der einzige ortsansässige Künstler bezeichnet wird, der es dem Jungen "mit reissen vorthun" könne, macht diese Hypothese Sinn; für seine Ausbildung zum Baumeister und Maler war es dagegen offenbar nötig, Sebastian zu einem auswärtigen Meister in die Lehre zu geben. Vgl. dazu auch Hahn-Woernle 1996: 14.
4 Vgl. dazu Dietz (1922: 49–67); Brauner (1933: 14); Bott (1997: 60–61); Heck (1997: 29–30). Dem immer wieder betonten guten Ruf von Daniel Soreau widerspricht allerdings eine Chronik der Neustadt Hanau, die unter dem Datum des 13. August 1605 vermerkt, daß dieser wegen Unzucht mit einer Dirne in Haft genommen und bestraft worden sei; vgl. die Publikation der Chronik bei Heinrich Bott (Bott 1971: II, 113).
5 Die Straßburger Räte erwähnen in dem Protokoll vom Dezember 1615, Daniel Soreau lasse seinen Zögling neben Malen auch die Laute schlagen und Ball spielen und hoffe, einen Albrecht Dürer aus ihm zu machen. Ausführliche Darstellung bei Brauner 1933: 11–15, mit Quellenauszug: 42–43).
6 Claus Grimm schreibt Daniel Soreau die Tafel eines opulent dargebotenen Früchtekorbes zu (Grimm 1979: 52, Abb. 38) und will diese Zuschreibung bekräftigt wissen (Grimm 1988: 206, Abb. 134–135), nachdem Sam Segal dieselbe Tafel an Jacob van Hulsdonck gibt (Kat. Amsterdam/Braunschweig 1983. 69). Sam Segal weist Daniel Soreau dagegen ein Blumenstück zu (vgl. Hahn-Woernle 1996: 54, Anm. 12). Zum Werk von Daniel Soreau vgl. zuletzt Bott 2001: 35–39.
7 Ein Schuldschein des Malers über die erkleckliche Summe von 121 livres und 7 sols verzeichnet seine Pariser Adresse: Stoskopff logierte bei einem Apotheker namens Monchenin nahe dem Kloster der Kleinen Kapuziner. Vgl. Heck 1997: 35; Kat. Straßburg 1997: 217–218.
8 Hahn-Woernle führt politische und religiöse Spannungen in Paris als möglichen Grund an (Hahn-Woernle 1996: 17); Heck verweist auf die Tatsache, daß sich um 1640 in Paris der Geschmack für Stilleben zu verändern begann, was sich auch darin bemerkbar macht, daß der Preis für Stoskopffs Bilder zwischen 1640 und 1650 deutlich sank (vgl. Heck 1997: 41 und Anm. 112).
9 Zur Biographie und zum Kunstsinn des Grafen Johannes von Nassau-Idstein vergleiche vor allem Berger 1987: 46–57 sowie Lentz 1994c: 41–53 (Biographie und Regierungszeit des Grafen Johannes) und 169–183 (Inventar seiner Kunstkammer und Gemäldegalerie).
10 Laut gräflichem Nachlaßinventar befanden sich im Jahre 1678, ein Jahr nach dem Tod des Grafen, noch fünf Arbeiten von Stoskopff im Schloß; bei den meisten Positionen des Inventars vermerkte der Schreiber jedoch den Namen des Künstlers nicht, so daß die Zahl der Gemälde von Stoskopff höher zu veranschlagen sein dürfte. Vgl. dazu auch Lentz 1994a und Berger 1987: 48 ff., im besonderen 51.
11
Zur Beschreibung der Bildnisse vgl. im vorliegenden Aufsatz die Anm. 17, sowie Lentz 1990: 165–172; Lentz 1994a: 165–166; Lentz 1994b: 5–7; jeweils mit dem Wortlaut des Briefes, der auch in anderer Hinsicht von Interesse ist:
PhiN-Beiheft 3/2006: 54
Baltasar Scheid, oben genannter Mittelsmann, war in Straßburg vom Grafen als Hofmeister zur Erziehung und Ausbildung der beiden älteren Söhne engagiert worden. Als Graf Johannes nach Idstein zurückkehren konnte, beließ er die beiden Söhne vorerst in Scheids Obhut. Der Ältere sollte in Straßburg auch im Malen unterrichtet werden, wozu sich Stoskopff auf Scheids Anfrage bereit erklärt und dafür seine Bedingungen genannt hatte: 100 Gulden jährliches Salär für täglich 1–2 Stunden Unterricht, jeweils nach der Mittagsmahlzeit im Hause des Malers. Baltasar Scheid äußert in diesem Brief nun seine Bedenken wegen des Lehrers Stoskopff: er hoffe, heißt es da über den jungen Grafen, "daß er sich in keinerley Weis, durch allerhand einfallende tiscursen, conversation und exempels, die nicht allzeit In Stoßkopffs Haus möchten zum richtigsten sein, werde ärgern laßen, sonst dörfte [...] das gemüht ungestalte bilder der sitten [...] auffassen." Leider wird Scheid in diesem Punkte nicht konkreter, so daß unklar bleibt, welcher Art "ungestalte Bilder der Sitten" gemeint sind und in welcher Hinsicht er Gespräche und Exempel im Hause Stoskopff für bedenklich hält. Graf Johannes jedenfalls empfiehlt Baltasar Scheid in einem Brief vom 28. Mai 1647, zur Kontrolle gelegentlich unangekündigt beim Unterricht vorbeizusehen.
12 Eine 1683 erstellte Beschreibung der Kunstkammer des Straßburgers Elias Brackenhofer verzeichnet fünf Gemälde von Sebastian Stoskopff, über den vermerkt ist: "Alß er von hrn. grafen Johann nacher Itstein gefordert ward, verfertigt er ihm etliche gemält und starb daselbst." (zitiert nach Rott 1930: 32)
13 Es handelt sich um zwei Bestellungen von Malmaterialien und eine Bestätigung über die Erstattung von Auslagen, die sich als Quittungen in der Beilage zu den gräflichen Kammerrechnungen im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden befinden und 1994 von Christel Lentz publiziert wurden. Vgl. Lentz 1994a: 167–169; Lentz 1994b: 8–10.
14
"Anno 1657 [...] Februarius Den 11. Febr. Ist Stoßkopf der Mahler von Straßburg, welcher Sich an Brandewein zu tod gesoffen, Morgens zwischen 7 und 8 Uhr zu ungewöhnlicher Zeitt ohne gesang und klang hinaußgetragen und begraben worden."
Vgl. dazu Brauner 1933: 25; Berger 1987: 58 und 63, mit einem Foto der entsprechenden Seite des Kirchenbuches. Vgl. auch Lentz 1994a: 170–171 und Lentz 1994b: 10–11, die anhand zweier im Hessischen Hauptstaatsarchiv aufgefundener Quittungen die Umstände der Beerdigung von Stoskopff näher beleuchten konnte.
15 Stoskopffs Tod hat Kunsthistorikern ebenso Anlaß zu Spekulationen geboten wie seinen Zeitgenossen; vgl. hierzu auch die Seiten 36f. dieser Arbeit. Alain Gruber zufolge starb Stoskopff sogar "à la suite d´une effrayante séance de sorcellerie et de beuverie." (Gruber 1983: 214).
16 Da der Straßburger Katalog zusätzlich zu Hahn-Woernle drei weitere signierte Gemälde verzeichnet (Kat. Nr. 30, 37 und Pl. 2), akzeptiert Heck demnach sechs Bilder nicht, die Hahn-Woernle als von Stoskopff eigenhändig signiert bezeichnet.
17 "An diesen aber hette er mehr fleis und Kunst, als sonsten, angewendet. Wegen der Kleidungen, des mardors, und kleinen gemälds, so er E. Gn. Gräflicher Gemahlin in der Hand zu halten angemahlt, darneben sich beflißen, daß er bey Hr. Christoh Abry die 2 rarsten tulipe bekommen, welche E. Gn. in der Hand zuhalten gemahlet auff der anderen Seite, auff einem Tischlein ein Zirkel, Bogen Papyr, darauf ein Vestung nach der fortification Kunst (wie er vorgibt), gerißen." (zitiert nach Lentz 1994b: 5). Desweiteren nennt der Brief auch die Preise für ein Porträt von Stoskopff: 6 Duplonen für ein bürgerliches Bildnis und 14 Duplonen für die gräflichen Porträts.
18 Kupferstich eines Porträts des Theologen Johannes Schmidt, 1641 datiert und mit den Worten "Sb. Stoskopff pinxit. P. Aubry sculpsit" bezeichnet; 25 x 16,5 cm; Straßburg, Cabinet des Estampes et des Dessins. Vgl. Kat. Straßburg 1997: Nr. 43, 206–207; Hahn-Woernle 1996: Nr. 48, 216–217; Haug 1948: Nr. 8, 63.
PhiN-Beiheft 3/2006: 55
19 Vgl. Berger 1987: 51; Lentz 1994c: 172–176.
Birgit Hahn-Woernle ordnet dem ein im Idsteiner Rathaus befindliches Porträt des Grafen Johannes zu (Hahn-Woernle 1996: Nr. 67, 263–264), eine fragwürdige Zuschreibung, da sich stilistisch kaum Anhaltspunkte für Stoskopffs Urheberschaft ergeben und nicht überliefert ist, wen das von Stoskopff gemalte Porträt im Besitz des Grafen zeigte, für dessen Schloß in Idstein eine umfangreiche Porträtgalerie belegt ist. Mit einleuchtenden Argumenten schreibt Christel Lentz das Bildnis dagegen dem Frankfurter Maler Johann Valentin Grambs zu; vgl. Lentz 1992: 168.
20 Das Nachlaßinventar der Witwe Susanna Soreau von 1621 nennt mehrheitlich Früchte, Blumen und Tierbilder. In alten Inventaren werden häufig auch Bilder mit diesen Motiven von Stoskopff erwähnt; vgl. dazu Kat. Straßburg 1997: 224–228; Hahn-Woernle 1996: 38–43. Die Straßburger Tafel mit der Darstellung einer Blumenvase, bislang für das früheste erhaltene Werk von Stoskopff angesehen (vgl. zuletzt Hahn-Woernle 1996: Nr. 1, 104–105), wurde mittlerweile aus Stoskopffs Œuvre genommen; vgl. dazu Bott 1997: 68–69; Heck 1997: 31–32; Heck 1999: 191–199. Ein signiertes Bild mit der Darstellung von lebenden Vögeln ist in Arras erhalten (Abb. 4).
21 Dabei sind Auswahl und Zusammenstellung der Einzelobjekte nicht unbedingt von einer übergeordneten Bildthematik geleitet, sondern willkürlich, das heißt unter künstlerisch-ästhetischen Gesichtspunkten vom Maler arrangiert. Es handelt sich hierbei gewissermaßen um eine definitorische Selbstverständlichkeit von Stilleben, da der Begriff Stilleben als Kompositum zweier Worte ursprünglich die Tätigkeit des Malers, nämlich die Abbildung still-liegender, leben-dig, also leibhaftig anwesender Gegenstände, in zweiter Linie das fertige Produkt und erst viel später die Gattung bezeichnete. Eine ausführliche Darstellung kunst- und sprachgeschichtlicher Definitionen gibt Eberhard König 1996: 13–92, hier insbesondere 19–20, 23–24, 32–34. Die künstlerische Praxis wird bei Interpretationen von Stilleben häufig nicht nur vernachlässigt, sondern steht nachträglichen Deutungen oft sogar entgegen!
22 Stoskopffs Bücher-Stilleben enthalten nahezu ausnahmslos die Darstellung graphischer Blätter. Am häufigsten zeigt Stoskopff Stiche von Jacques Callot (vgl. die Abb. 19, 20, 26 und 39); von Rembrandt malte er zwei Radierungen (Abb. 21 und 47), von Laurent de La Hyre und Michel Dorigny je eine (Abb. 22, 44). Die übrigen gemalten Stiche konnten bislang nicht identifiziert werden. Zu gemalter Graphik bei Stoskopff vergleiche vor allem Böhmer 1997: 94–107. Nach Heck 1997: 29, könnte die Vorliebe für gemalte Stiche auf Stoskopffs Lehre bei Friedrich Brentel zurückzuführen sein.
23 Das Inventar einer Straßburger Kunstsammlung nennt "ein Nachtstück mit Oelfarb, altes Weib und junger Kerl, vom Stoßkopf Argentinensi" (Sammlung des Jean-Jacques Arhardt, zitiert nach Rott 1930: 24), Thema eines Genrebildes, wobei die Vermutung nahe liegt, daß es sich dabei ebenfalls um ein Stilleben mit Genrecharakter im oben genannten Sinne handelte. Zwei weitere nur aus Inventaren bekannte Werke von Stoskopff hatten Themen von Genrebildern: Des fummeurs aus der Sammlung des Jean-Baptiste de Bretagne (Inv.-Nr. 165) sowie die Gouache (!) Vielle femme assise, un cruchon à la main aus einer Straßburger Sammlung; vgl. Hahn-Woernle 1996: 38 und 42, sowie 90, wo sie die Hypothese äußert, die Bilder könnten Kupferstiche wiedergegeben haben.
24 Ein bislang Stoskopff zugeschriebenes Gemälde in Straßburg mit der Darstellung eines eine Tafel abräumenden Jünglings (vgl. zuletzt Hahn-Woernle 1996: Nr. 27, 161–163) wurde inzwischen seinem Œuvre genommen (vgl. Dupeux 1997: 23 und Anm. 14). Eine von diesem Gemälde existierende Kopie mit der Monogrammierung E R wurde von Grimm 1995: 182–183 und Hahn-Woernle 1996: Nr. 28, 164–165, ebenfalls Stoskopff zugeschrieben. Letztere schreibt Stoskopff darüber hinaus ein Interieur mit kleinem Mädchen zu (Hahn-Woernle 1996: Nr. 29, 166–167), das stilistisch jedoch deutlich aus seinem Werk herausfällt.
25
Signiert ist keines der vier Bilder, die Zuschreibung an Stoskopff wird jedoch allgemein akzeptiert. Auch Michèle-Caroline Heck behandelt die vier Bilder im Kat. Straßburg 1997: 192–193, ohne deren Zuschreibung an Stoskopff in Frage zu stellen. Deshalb ist es nicht nachvollziehbar, weshalb die auf Seite 192 abgebildete Version aus Burnley die Bildunterschrift Anonyme trägt.
PhiN-Beiheft 3/2006: 56
26 Zwei weitere Bilder von Stoskopff gehören thematisch und kompositionell ebenfalls zu dieser Gruppe; vgl. Hahn-Woernle 1996: Nr. 45 und 46, 208–212.
27 Spielende Kinder mit einem Ziegenbock, Nachahmung einer Federzeichnung auf Leinwand, signiert und datiert 1646, ehemals Gemäldegalerie Dresden, im Jahre 1859 versteigert; vgl. Holzhausen 1944: 112.
28 Das Künstlerlexikon Thieme-Becker (1938: XXXII, 139) nennt Stoskopff "Stillebenmaler (u. Kupferstecher?)", dasjenige von Emmanuel Bénézit (1999: XIII, 285) "peintre de genre, natures mortes, fleurs et fruits, graveur au burin." Haug (1948: 71–72) zitiert ältere Literatur und Inventare, die auf eine graphische Betätigung von Stoskopff hinweisen; er betont jedoch, daß keine Zeichnungen oder Stiche von Stoskopff bekannt sind. Diese Position vertritt auch Hahn-Woernle (1996: 90–91) in dem Exkurs Hat Sebastian Stoskopff Kupferstiche gefertigt?, während Berger (1987: 51) davon ausgeht, Stoskopff habe Kupferstiche geschaffen.
29 "Dieses Kupferstuck were leicht auf Stoßkopfische Manier zu machen, wan dergleichen, alss Stoßkopf gewesen, noch lebeten." Matthäus Merian d. J. in einem Brief vom 18. Dezember 1657 an den Grafen Johannes von Nassau-Idstein, zitiert nach Berger 1987: 51.
29a Nicht uninteressant erscheint dem Autor an dieser Stelle der Hinweis, daß das Motiv einer einzelnen Zitrone und eines Zinntellers vor undefinierbar dunklem Hintergrund etwa zweieinhalb Jahrhunderte später den Maler Edouard Manet beschäftigen sollte. Das kleine Gemälde "Le citron" im Pariser Musée d'Orsay (1880, Öl auf Leinwand, 14 x 22 cm, Inv. RF 1997) gibt davon Zeugnis, daß einer der führenden Maler der Moderne hinsichtlich des Motivs wie des Bildaufbaus vergleichbare künstlerische Fragen an ein Stilleben richtete, wie sie bereits Sebastian Stoskopff umgetrieben hatten.
30 Faré 1962: I, 90: "Le thème de la vanité avait trouvé chez lui une expression dramatique qui n´a jamais été dépassée." Faré 1962: I, 110: "Sébastien Stoskopff est véritablement hanté par le thème de la vanité qu´il renouvelle singulièrement." Vgl. auch Faré 1974: 124 und 127-132.
31 Im Vorwort zum Ausstellungskatalog versichert Peter Berghaus, daß es sich um eine dezidiert kulturhistorische Ausstellung handle, die vorrangig nach dem Bildinhalt frage: "Der Funktion des Kunstwerks wird der gleiche Stellenwert eingeräumt wie der Meisterschaft des einzelnen Künstlers." (Kat. Münster 1979: 7). Tatsächlich wird über die oft spekulative Suche nach Funktion und Deutung des Bildes der aus ihm selbst zu entnehmende künstlerische Wert vernachlässigt oder ganz vergessen.
32 Wright 1985: 94–95: "There is therefore no complex iconography behind such a depiction; it is just a careful record of an everyday sight."
33 Zu stützen wäre diese Einschätzung auch durch Wölfflins Theorie der "Kunstgeschichtlichen Grundbegriffe", deren erstes Begriffspaar, linear und malerisch (Tastbild und Sehbild), eine Zuordnung der Bilder zur Kategorie linear und Tastbild verlangt und damit die kompositorische wie stilistische Nähe der Werke zum 16. Jahrhundert unterstreicht. Stilleben kommen in Wölfflins Theorie nicht vor, seine Definition des linearen Tastbildes charakterisiert die frühe Stillebenmalerei jedoch treffend. Vgl. Wölfflin 1943: 20–23.
34 Zitiert nach Wheelock 1977b: 93; eine deutsche Übersetzung findet sich bei Alpers (1985: 58):
PhiN-Beiheft 3/2006: 57
"Ich habe bei mir das andere Gerät Drebbels, das wahrlich wunderbare Effekte malerischer Widerspiegelung in einer dunklen Kammer erzeugt. Unmöglich, euch deren Schönheit mit Worten zu beschreiben: Alle Malerei ist tot im Vergleich, denn dies hier ist das Leben selbst, oder etwas noch Erhabeneres, wenn nur nicht die Worte dafür fehlten. Denn sowohl Gestalt als auch Kontur und Bewegungen treten darin auf natürliche und überaus gefällige Weise zusammen."
35 Die hohe Wertschätzung für ein nach der Natur gemaltes Bild, dessen Realismus durch den Gebrauch einer camera obscura noch gesteigert werden kann, steht damit in krassem Gegensatz zur akademischen Doktrin der Zeit, die diese "unkünstlerische" und deshalb rein handwerkliche Malerei an das unterste Ende ihrer Werteskala setzt.
36 Auf welche Weise Constantijn Huygens den Nachweis des Gebrauchs einer camera obscura geführt haben will, wird leider nicht übermittelt.
37 de Boer 1934: 63: "Er gaat van dit werk een eigenaardige, bijna geheimzinnige stemming uit, waardoor men zich afvraagt, waar en onder wiens invloed deze kunstenaar gewerkt heeft. Er zijn weinig kunstenaars, met wiens werk men het zijne kan vergelijken. Misschien spreekt een gelijke stemming uit de schilderijen van een Torrentius en van een Vrel."
38 Inventarienbuch der Neustadt Hanau 1611–1625, Bl. 345/346 und 350–354, Archiv des Hanauer Geschichtsvereins; vgl. Bott 1962: 30–32 und Anm. 26. Aufgeführt sind hauptsächlich Werke über Architektur, Notenbücher (meist Chordichtungen bekannter italienischer und französischer Komponisten) und Kunstbände mit Kupferstichen und Portraits.
39 Ein 1719 erschienener Traktat von Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, reinterpretiert unter diesem Gesichtspunkt auch den seit der Antike beständigen Topos der Augentäuschung: Nicht in der Täuschung des Betrachters liege in erster Linie der Reiz eines solchen Kunstwerks, sondern im sinnlichen Vergnügen an seinem kunstvollen Charakter, welches auch dann weiter bestehe, wenn die Täuschung längst durchschaut sei. Vgl. Bauer 1992: 283–284. Für Stoskopffs Stilleben ist dieser Punkt von Belang, da bei Betrachtung seiner Trompe-l´œils ein Täuschungserfolg schwer vorstellbar scheint.
40 Thuillier 1997: 21: "Quelques fraises, une orange, un pain, un lièvre mort, une terrine, l´éclat froid d´un métal précieux n´ont alors nul besoin d´une signification symbolique, qui ne peut être qu´un prétexte bien pauvre."
Bildnachweise
Abbildungen 1–10, 12–36, 38–41, 43, 44, 47, 48: Hahn-Woernle, Birgit (1996): Sebastian Stoskopff. Stuttgart.
Abbildungen 11, 42: Kat. Straßburg/Aachen (1997): Sébastien Stoskopff 1597–1657. Un maître de la nature morte. Musée de l´Œuvre Notre-Dame/Suermondt Ludwig Museum.
Abbildung 12b: Ausstellungskatalog Paris/Baltimore 2000/2001: Manet. Les natures mortes, Musée d'Orsay/ The Walters Art Gallery, Kat. 37, S. 112
Abbildung 37: Menzhausen, Joachim (1968): Das Grüne Gewölbe. Fotos von Gerhard Reinhold, Berlin: Abb. 122.
PhiN-Beiheft 3/2006: 58
Abbildung 45: Zeitschrift für Kunstgeschichte 54 (1991): 459.
Abbildung 46: Kat. Amsterdam (1993/94): Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580–1620 Rijksmuseum: 290
Nachbemerkung
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine geringfügig überarbeitete Fassung der Magisterarbeit, die bereits im Sommer 1997 am Kunsthistorischen Institut der Freien Universität Berlin eingereicht wurde. Herausgeber und Verfasser sind jedoch zu der Auffassung gelangt, dass diese Arbeit, da sie sich mit grundlegenden Fragen zu Stoskopffs Werk befasst, auch fast zehn Jahre später in dieser Fassung als Beiheft der wissenschaftlichen Zeitschrift PhiN erscheinen kann. Der Entstehungszeit ist auch die Tatsache geschuldet, dass der Text noch in der alten Rechtschreibung publiziert wird, in der er – den damaligen Gepflogenheiten gemäß – verfasst wurde.
Dem Herausgeber der Zeitschrift PhiN und des vorliegenden Beihefts, Peter Schneck, bin ich für die Möglichkeit der Publikation ebenso zu herzlichem Dank verpflichtet wie für sein großes Engagement, einer 'herkömmlichen' Arbeit auf Papier die Form zu verleihen, derer eine Online-Publikation bedarf. Verfasser und Herausgeber danken außerdem Helen Malich für ihre Hilfe bei der technischen Bearbeitung des Manuskripts. Eberhard König bin ich für sein persönliches Vorwort sehr dankbar, vor allem jedoch dafür, dass er mich in der Kunstgeschichte das Sehen gelehrt hat. Genau darum nämlich geht es in dieser Arbeit: um optische Phänomene sowie um den spezifischen Blick des Künstlers auf die darzustellenden Objekte, den wir vor lauter Deutungsversuchen oftmals aus dem Auge zu verlieren drohen.